Medien
Die Abteilung Marketing und Kommunikation ist für die interne und externe Kommunikation, Medienarbeit, Marketing, Publikationen sowie Veranstaltungen zuständig und steht allen Medienschaffenden gerne zur Verfügung.
Bei Medienanfragen oder Intresse an Medienmitteilungen aus vergangenen Jahren, können Sie sich an die Abteilung Marketing und Kommunikation wenden:
T 062 916 35 08
marketing(at)sro.ch

Neue Zusammenarbeit mit dem Rückenzentrum Oberaargau
Seit Beginn des Jahres 2025 arbeitet die Spital Region Oberaargau AG mit dem Rückenzentrum Oberaargau AG zusammen. Das Ärzteteam des Rückenzentrums behandelt Patientinnen und Patienten nun auch in den Räumlichkeiten der Wirbelsäulenmedizin und -chirurgie des Spitals Langenthal. Die Praxis des Rückenzentrums in Langenthal bleibt vorerst bestehen; ein späterer Umzug ins Spital ist geplant.
Das vierköpfige Ärzteteam des Rückenzentrums Oberaargau arbeitet seit Anfang Jahr mit der Ärzteschaft der Wirbelsäulenmedizin und -chirurgie der SRO AG zusammen und führt die Operationen neu im Spital Langenthal durch. Patientinnen und Patienten werden gemeinsam besprochen und triagiert. Sprechstunden werden in nächster Zeit weiterhin in der Praxis an der Marktgasse in Langenthal durchgeführt. Mittelfristig soll das Rückenzentrum in die SRO AG umziehen.
Kompetenzen bündeln und Infrastruktur gemeinsam nutzen
Durch die Zusammenarbeit kann Fachkompetenz gebündelt und ein grösseres Behandlungsspektrum bei sämtlichen Erkrankungen der Wirbelsäule angeboten werden. Dank der Erweiterung des Teams können wir mehr Kapazitäten für Behandlungen anbieten, ohne dabei Kompromisse bei der gewohnt hohen medizinischen Qualität einzugehen.
Bildlegende (v.l.n.r.): PD Dr. med. Sven Hoppe, Dr. med. Sonja Vulcu, Prof. Dr. med. Ulrich Berlemann und Dr. med. Fabian Aregger vom Rückenzentrum Oberaargau AG arbeiten seit Anfang Jahr mit der Wirbelsäulenmedizin und -chirurgie der SRO AG zusammen.

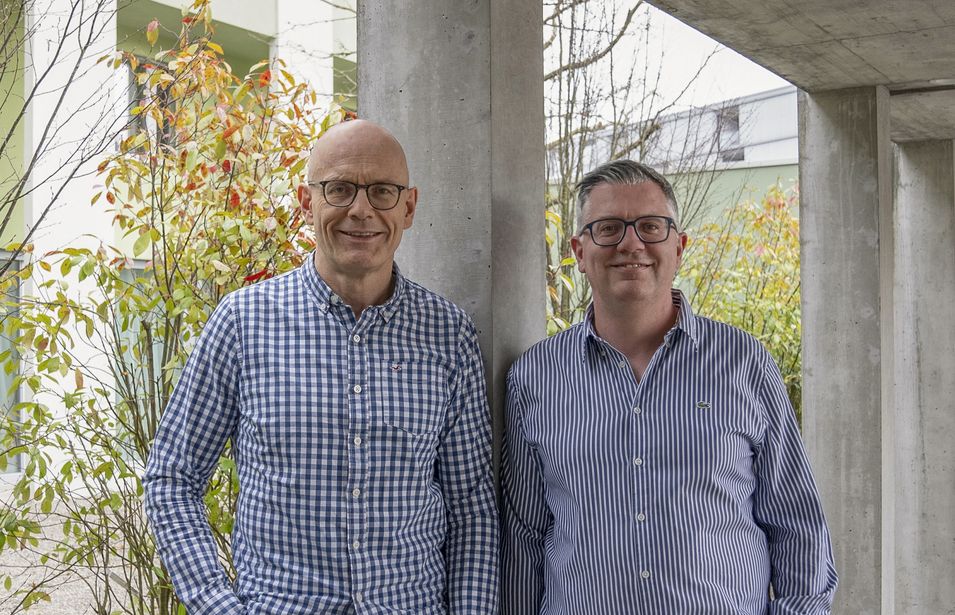
Ein Brustzentrum – zwei Standorte
Die Spital Region Oberaargau AG und die Spital Emmental AG bauen ein gemeinsames interdisziplinäres Brustzentrum auf. Das Brustzentrum Emmental-Oberaargau ermöglicht den Patientinnen und Patienten eine umfassende und wohnortnahe Betreuung nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen.
Mehr als 6500 Frauen und rund 50 Männer erkranken jährlich in der Schweiz an Brustkrebs, der häufigsten Form von Krebs bei Frauen. Die Spital Region Oberaargau (SRO) AG und die Spital Emmental (SE) AG bündeln ihre Expertise in der Behandlung von Brustkrebs und bauen gemeinsam das Brustzentrum Emmental-Oberaargau auf. Dieses bietet an den zwei Standorten Langenthal und Burgdorf die umfassende und qualitativ hochstehende Abklärung, Behandlung und Nachsorge bei einer Brustkrebserkrankung an, basierend auf den neusten medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Spezialistinnen und Spezialisten der Gynäkologie, Radiologie, Onkologie und Psychoonkologie arbeiten an beiden Standorten und standortübergreifend eng zusammen. Sie sind zudem vernetzt mit externen Partnern wie der rekonstruktiven Chirurgie oder der Radio-Onkologie. Zwischen den Kernteams beider Spitäler findet ein regelmässiger Austausch statt, alle Patientinnen und Patienten werden zudem an einem gemeinsamen interdisziplinären Tumorboard besprochen. Aus dem breiten Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten – chirurgische Eingriffe, medikamentöse Therapien, Strahlen- oder Immuntherapien – wird für jede brustkrebserkrankte Person ein personalisierter Behandlungsplan zusammengestellt.
Pflegeexpertinnen für Brusterkrankungen, sogenannte Breast Care Nurses, begleiten und betreuen die Betroffenen während des gesamten Behandlungsprozesses engmaschig und stehen ihnen als konstante Ansprechperson während der ganzen Behandlung zur Verfügung. Personen, die an Brustkrebs erkranken, können sich so in der Nähe ihres Arbeits- oder Wohnortes behandeln lassen; sie werden von einem Team betreut.
Behandlung in einem Brustzentrum wirkt sich positiv aus
Eine wichtige Voraussetzung für eine optimale Behandlung von Brustkrebs ist die Früherkennung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit von mehreren Spezialistinnen und Spezialisten. «Die Bündelung von Fachkompetenz hat einen positiven Effekt auf den Langzeiterfolg der Behandlung von brustkrebserkrankten Personen», sagt Dr. med. Thomas Eggimann, stv. Chefarzt der Frauenklinik des SE und Leiter des Brustzentrums Standort Burgdorf. Studien zeigen, dass Behandlungen in Brustzentren bessere Langzeitergebnisse haben. Dr. med. Daniele Bolla, Chefarzt der Frauenklinik SRO AG und Leiter des Brustzentrums Standort Langenthal: «Der grosse Vorteil eines Brustzentrums ist, dass die spezialisierten Fachpersonen aus verschiedenen Disziplinen interdisziplinär zusammenarbeiten und somit während der gesamten Behandlung – von der präventiven Untersuchung bis zur Nachsorge – wohnortsnah eine Medizin nach neustem Standard anbieten können.»
Das Brustzentrum Emmental-Oberaargau strebt die Zertifizierung nach den Vorgaben der Krebsliga Schweiz und der schweizerischen Gesellschaft für Senologie an. Dieses Qualitätslabel wird an Zentren vergeben, die klar definierte Anforderungen an Diagnostik, Behandlung und Nachsorge erfüllen.
Ein weiterer Schritt in Richtung Spital- und Versorgungsregion Emmental-Oberaargau
«In naher Zukunft wird es nicht mehr möglich sein, Brustkrebs in Spitälern ohne entsprechende Zertifizierung zu behandeln, unabhängig davon, ob erfahrene Operateure mit dem entsprechenden Schwerpunkt für Senologie verfügbar sind», sagt Regula Feldmann, CEO der Spital Emmental AG. Sowohl das Spital Emmental als auch das Spital Region Oberaargau generieren alleine zu wenig Fälle, um ein eigenes Brustzentrum zu bilden. «In der Zusammenarbeit ergeben sich die für die Zertifizierung benötigten Fälle», ergänzt Regula Feldmann und fährt fort: «Das Brustzentrum Emmental-Oberaargau ist ein weiterer Schritt Richtung Versorgungs- und Spitalregion Emmental-Oberaargau.»
«Unsere Partnerschaft ermöglicht es beiden Spitalgruppen, den Leistungsauftrag zur Behandlung von bösartigen Brusttumoren mittelfristig zu sichern. Denn nur so können wir garantieren, dass die an Brustkrebs erkrankten Personen auch weiterhin in der Region behandelt werden können, entweder in Burgdorf oder Langenthal», erläutert Andreas Kohli, Direktor der SRO AG und sagt weiter: «Unser Brustzentrum mit den beiden Standorten bietet Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen den Zugang zu einer Behandlung von höchster medizinischer Qualität, kombiniert mit einer emphatischen, umfassenden und persönlichen Betreuung.»
Die Rettungsdienste der Spital Emmental AG und der Spital Region Oberaargau AG schliessen sich zusammen zum «Rettungsdienst Emmental-Oberaargau».
Die Rettungsdienste der Spital Emmental AG und der Spital Region Oberaargau AG arbeiten seit Beginn des Jahres als «Rettungsdienst Emmental-Oberaargau» zusammen. Gemeinsam setzen sie so den Leistungsauftrag der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI) um.
Ressourcen schonen und Infrastruktur gemeinsam nutzen
Beim Rettungsdienst Emmental-Oberaargau handelt es sich juristisch um eine einfache Gesellschaft, bei der beide Spitäler gemeinsam die Trägerschaft bilden. «Dies ist ein wichtiger Schritt in die Vereinheitlichung von rettungsdienstlichen Prozessen», sagt Regula Feldmann, CEO Spital Emmental AG. «Wir arbeiten schon lange gut und eng mit dem Rettungsdienst der SRO AG zusammen. Unsere Strukturen und Bedingungen sind sehr ähnlich.» Das Ziel ist es, diese Prozesse bis Ende 2027 zu harmonisieren. Im Rahmen des von der GSI geplanten 4+-Regionen Modell sind die beiden Spitäler die ersten, die ihre Rettungsdienste in diesem Rahmen neu organisieren. «Als grösserer Rettungsdienst haben wir eine bessere Marktposition, können unsere Ressourcen schonen und sind dadurch effizienter unterwegs», ergänzt Andreas Kohli, Direktor SRO AG.
Mitarbeitende in den Prozess und die Entwicklungen einbinden
Als Co-Leitung des Rettungsdienstes Emmental-Oberaargau konnten Mischa Schori und Thomas Giger gewonnen werden. Beide fungierten vorher als Leiter Rettungsdienst für das Emmental respektive für das Oberaargau. Die beiden kennen sich gut und arbeiten bereits jetzt gut zusammen. «Ich sehe in diesem Zusammenschluss sehr viele Vorteile. So können wir für unsere Patientinnen und Patienten in unserem Einzugsgebiet eine noch bessere und schnellere Notfallversorgung bieten», erklärt Mischa Schori. «Man kennt sich sowieso schon sehr gut und bei der Arbeit an den Patientinnen und Patienten verfahren wir dank denselben Standards und Ausbildungen gleich», sagt Thomas Giger ergänzend. Durch den Zusammenschluss wird die Flexibilität bei den personellen Ressourcen erhöht. Bei personellen Engpässen kann man sich gegenseitig aushelfen. Für die Mitarbeitenden gibt es keine grösseren Veränderungen. Gleiches gilt für Patientinnen und Patienten – sie profitieren rund um die Uhr vom gemeinsamen Einsatz des Rettungsdienstes Emmental-Oberaargau.

«Mit Teamgeist zum Erfolg» steht im Leitbild der SRO AG. Diesen Teamgeist haben die SRO-Mitarbeitenden anlässlich der Re-Zertifizierung nach sanaCERT suisse erfolgreich bewiesen; die SRO AG hat mit Punktemaximum bestanden. Zu diesem Schluss kamen vier externe Auditoren, welche das Qualitätsmanagement der SRO AG während zweier Tage intensiv geprüft haben.
Am 6. und 7. September 2022 fand am SRO Standort Langenthal die Re-Zertifizierung nach sanaCERT suisse statt. Nach der Erst-Zertifizierung im Jahr 2010 stellte sich die SRO AG bereits der vierten Re-Zertifizierung. Während zweier Tage beurteilten vier externe Auditorinnen und Auditoren der Stiftung sanaCERT suisse das Qualitätsmanagement-System der SRO AG anhand der folgenden Standards:
- Qualitätsmanagement
- Infektionsprävention und Spitalhygiene
- Umgang mit kritischen Zwischenfällen
- Mitarbeitende Menschen – Human Resources
- Umgang mit akut verwirrten Patientinnen und Patienten
- Rettungsdienst
- Sichere Medikation
- Feedbackmanagement
Die Auditorinnen und Auditoren beurteilten pro Standard die Umsetzung sowie die Durchdringung. Dazu fanden stichprobeweise Befragungen von Mitarbeitenden aus verschiedenen Fachbereichen statt. Die SRO AG ist stolz auf Ihre Mitarbeitende: das Re-Zertifizierungsaudit wurde mit Bestnote bestanden.



Mit grosser Freude verkündet das Hebammenteam der SRO AG die erste Geburt im Geburtshaus Viola. Kurz nach der Eröffnung, am Morgen des 13. Juni 2022, erblickte Alissa schnell und putzmunter, unter der kundigen Begleitung der Beleghebamme Frau Zuzka Hofstetter, das Licht der Welt.
Die Eltern sind voller Stolz und fühlen sich rundum wohl im neuen, gemütlichen Geburtshaus. «Die Geburt von Alissa ist reibungslos verlaufen – wir sind einfach nur glücklich.» Wo vor langer Zeit einst das Frauen-spital angesiedelt war, der Ursprung vom Spital Langenthal, befindet sich nun das neue Geburtshaus Viola.
Philosophie
Dem Hebammenteam rund um Frau Christa Gutknecht, Leitende Hebamme, liegt es besonders am Herzen, das Vertrauen der Schwangeren in ihre eigene Kraft und die natürlichen Vorgänge im Körper zu stärken. Jede Frau soll ihr Kind in ihrem eigenen Rhythmus in einem geschützten, persönlichen Rahmen gebären. Durch die kontinuierliche Hebammenbetreuung wird die Familie optimal unterstützt und begleitet.
Grösstmögliche Sicherheit
Bei einem akuten medizinischen Notfall stehen jederzeit die geburtshilfliche Ärzteschaft und die moderne Infrastruktur der SRO Frauenklinik bereit, um rasch intervenieren zu können und die werdende Familie unter der Geburt weiter zu begleiten.
Eine anspruchsvolle Zeit liegt hinter dem Screening- und Impfpraxis-Team der SRO AG. Über 50'000 Abstriche wurden gemacht und 125'700 Impfungen verabreicht.
Dank an die Mitarbeitenden
Der steilste Abschnitt des Weges in die Normalität liegt hinter uns, jedoch ist der Weg stets steinig und erfordert nach wie vor den täglichen unermüdlichen Einsatz der Mitarbeitenden des ganzen Spitals Langenthal. Rund 200 Mitarbeitende der Impfpraxis und vom Testcenter haben Höchstleistungen erbracht. Dafür bedankt sich die Direktion der SRO AG herzlich und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.
Tests und Impfungen in der SRO AG noch möglich
Die Impfpraxis im 2.OG und das Testcenter werden am 31.03.2022 geschlossen. Weiterhin werden im kleineren Rahmen Impfungen und Covidtests angeboten. Diese werden ab dem 04. April 2022 über die bekannten Buchungsmöglichkeiten, im angepassten Testcenter durchgeführt.
Die unvorstellbare Situation in der Ukraine macht uns alle nachdenklich und betroffen. Verwaltungsrat und Direktion der SRO AG und der dahlia oberaargau ag haben daher entschieden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein Zeichen der Unterstützung für die betroffene Bevölkerung vor Ort zu setzen.
Spende an Glückskette
Die SRO AG hat zusammen mit der dahlia oberaargau ag einen Betrag von CHF 50'000.00 an die Glückskette zu Gunsten der Ukraine gespendet. Die Glückskette steht in ständigem Austausch mit ihren Schweizer Partnerorganisationen vor Ort und ist auch selber mit Personal vor Ort präsent. Mit den Geldspenden kann so gut als möglich eine bedarfsgerechte Katastrophen- und humanitäre Hilfe für die Betroffenen organisiert werden. Unsere Gedanken sind bei der ukrainischen Bevölkerung. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.
Die Einzigartigkeit jeder Geburt steht für das Hebammenteam der SRO AG im Mittelpunkt. Eine einfühlsame und persönliche Betreuung ist genauso wichtig wie gegenseitiges Vertrauen und die Gewissheit, dass die schwangeren Frauen von einem kompetenten Team begleitet werden.
Geburten im 2021
Im 2021 erblickten in der Frauenklinik der SRO AG 673 Kinder das Licht der Welt. 354 Knaben und 319 Mädchen. Davon 7 Zwillinge.
Moritz – das Neujahrsbaby
Am 01.01.2022 um 01.32 Uhr konnte das erste Kind im Jahr 2022, ein Knabe Namens Moritz, im Spital Langenthal begrüsst werden.
Im September 2021 fand bei wunderschönem Herbstwetter bereits der 10. Jahresanlass der
ambulanten Herzrehabilitation des SRO Spitals Langenthal statt. 110 ehemalige Teilnehmende der Rehabilitation ergriffen die Gelegenheit und nahmen am beliebten Anlass teil.
Dieses Jahr etwas anders
Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage wurden die rund 110 Teilnehmenden in drei Gruppen
unterteilt. Die diesjährige Jahreswanderung der ambulanten Herzrehabilitation führte die Teilnehmenden, nach der Besammlung bei der Alten Mühle Langenthal, der schönen Langete nach. Als Erinnerung an dieses Jubiläum erhielten alle noch eine schöne SRO-Grüne Thermosflasche.
Nach der Ansprache von Tanja Sturzenegger, verantwortliche Physiotherapeutin der ambulanten kardialen Rehabilitation und Organisatorin des Anlasses, wurden die Wandersleute im grossen Saal der Mühle kulinarisch verwöhnt. Anschliessend wurden noch die Hirnzellen der Teilnehmenden mit einem Quiz gefordert. Timo Thimm, Leiter Med. Tech. Dienste / Akutpfllege Stationen machte das Schlusswort.
Das Treffen wird jeweils von der Stiftung SRO und dahlia oberaargau finanziell unterstützt.
Ambulante kardiale Rehabilitation
Die ambulante kardiale Rehabilitation der SRO AG wurde im Herbst 2008 gegründet. Unter ärztlicher Leitung der Herzspezialisten Patrick Hilti, Michael Bergner, Fabian Zürcher, Stefan Bühler und Kai Schmidt sowie einem Team von speziell ausgebildeten Physiotherapeutinnen unter der Leitung von Susanne Sommerhalder und Ernährungsberatern der SRO konnten bisher bereits über 900 Patienten von diesem Angebot in Wohnortnähe profitieren.
Die ambulante Herzrehabilitation hat zum Ziel, nach einem Herzinfarkt oder einer Herzoperation die körperli-che Leistungsfähigkeit wiederaufzubauen, das Vertrauen in den Körper zurück zu gewinnen und Änderungsmöglichkeiten für einen langfristig gesunden Lebensstil aufzuzeigen. Da ein anhaltender Erfolg der Rehabilitation davon abhängt, ob Erlerntes auch im Alltag weitergelebt wird, bietet das Programm der SRO ein vielfältiges Angebot an, um individuellen Vorlieben gerecht zu werden.
Ehemalige Patientin der Herzrehabilitation erzählt
Susanne R. hatte im 2015 einen Herzinfarkt. Plötzlich war nichts mehr so wie es einst war. Durch die gute Betreuung durch die Physiotherapeuten der SRO in der Herzrehabilitations-Gruppe fasste Susanne R. wieder Mut. «Die Gruppendynamik hat mir nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr gutgetan und mir die Angst genommen. Wir alle haben ähnliches erlebt und durchgemacht – das tut einfach gut. Ich freue mich immer auf die Jahrestreffen und meine Gruppenmitglieder von damals wieder zu sehen.» Auch Hanspeter Gygax ist ein langjähriges Mitglied des Jahrestreffs. «Ich bin heute das 10. Mal dabei und freue mich immer wieder auf diesen geselligen Anlass!» Dass die PhysiotherapeutInnen sich mit Herz für ihre Patienten einsetzten zeigt diese Aussage von Susanne R.: «Meine tolle Therapeutin hat mich sogar in die erste Tanzstunde nach dem Herzinfarkt begleitet, da ich solche Angst hatte wieder an den Ort des Geschehens zurückzukehren. Dies werde ich ihr mein Leben lang nicht vergessen!»
Der Kanton Bern hat beschlossen die Impfzentren per Ende August zu schliessen. Ab September wird es dennoch möglich sein, seine Impfdosis in Langenthal zu erhalten.
Spitalpraxis im Spital Langenthal
Im 2. OG des Bettenhochhauses des Spitals Langenthal wird neu ab September eine Spitalpraxis integriert, in welcher ausschliesslich Covid-19-Impfungen durchgeführt werden.
Erster und zweiter Impftermin
Ersttermine im August können nicht mehr über das Impfzentrum Langenthal gebucht werden, sondern sind bereits in der Spitalpraxis aufgeschaltet.
Die Ersttermine bis zum 20. August 2021 für eine Impfung finden noch im Impfzentrum in der Alten Mühle statt. Die folgenden Zweittermine werden nicht mehr am Mühleweg 23 stattfinden, sondern im 2. OG vom Bettenhochhaus im Spital Langenthal an der St. Urbanstrasse 67.
Anmeldungen
Anmeldungen für die COVID-19 Impfungen in der Spitalpraxis können ab sofort direkt über https://be.vacme.ch/start getätigt werden. Es sind genügend Termine vorhanden.
Jedes Gericht, welches die SRO Küche verlässt, wurde mit viel Leidenschaft kreiert. Auch der Einkauf der Lebensmittel wird mit Hingabe geplant und es wird sehr auf Regionalität und Nachhaltigkeit geachtet – getreu dem Motto «aus der Region, für die Region».
Dem SRO ist es ein Anliegen, die Region Oberaargau zu unterstützen und einen verantwortungsvollen Umgang mit den zu Verfügung stehenden Ressourcen zu pflegen. Darum wird seit Jahren bei lokalen
Lieferanten eingekauft.
Übersicht Zutaten und Lieferanten
- Kartoffeln und Eier stammen von einem Bauernhof in Langenthal.
- Milch und Milchprodukte sind von einer Käserei in Aarwangen (Kühe aus der Umgebung).
- Fleisch ist aus der Schweiz oder aus der regionalen Produktion einer Metzgerei in Kleindietwil.
- Fische sind ausschliesslich aus heimischen Gewässern (Hallwilersee und Thunersee) – seit 2020 gibt es keinen Fisch mehr aus Übersee (z. B. Lachs oder Pangasius).
- Gemüse und lokale Früchte sind aus Lotzwil oder aus dem Seeland (regional oder CH-Herkunft).
- Brot und Brotgebäcke werden in Langenthal hergestellt.
- Bio-Zopf für Privatpatienten sind aus einer Stiftung in Madiswil.
Menüplanung
Es existiert ein Jahresplan, welcher sich an den saisonalen Verfügbarkeiten orientiert. Das Menü wird jeweils 3 bis 4 Wochen im Voraus im Detail geplant. Die Ernährungsberatung prüft zusätzlich, ob die Zutaten gemäss Nährwerttabelle ausgewogen verteilt sind. Bei der Planung ist das Küchenteam im Austausch mit den Lieferanten, wobei sich auch andersrum die Lieferanten melden, wenn etwas Besonderes, wie z. B. Spargel oder Erdbeeren bereit zur Ernte sind. Alle Desserts werden übrigens in der hauseigenen Konditorei kreiert.
Für die Patienten wird jeden Tag nach einem Produktionsplan gekocht. So wird sichergestellt, dass genau so viel gekocht, wie auch benötigt wird. Täglich wird mit einer internen Patientenbefragung ermittelt, wie die Essensmenge empfunden wurde. Zusätzlich werden Resten, die von Patienten zurückkommen gewogen, um auch auf diesem Weg die optimale Speisemenge zu evaluieren.
Fürs Personalrestaurant wird immer frisch und nach Bedarf zubereitet. Falls aus dem Personalrestaurant (es gibt ein bedientes Buffet) doch mal etwas übrigbleibt, wird solches weiterverarbeitet (Salate, Eintopf-gerichte, Saucen, Suppen etc.).
Trends und Ziele
Das SRO hat das Ziel, die Fahrtwege und den PET- bzw. Plastik-Verbrauch stetig zu reduzieren. Aufgrund dessen wird den Patienten gefiltertes Langenthaler Trinkwasser in einer Karaffe aus recyceltem Material serviert. Des Weiteren werden Desserts nur noch in Weck-Gläsern angerichtet. Auf Einweggeschirr wird verzichtet. Klarsichtfolien werden nur noch zum Abdecken gebraucht. Im Grösseren ist auch Ziel, dass der CO2-Ausstoss minimiert und weniger Fleisch serviert wird. Manchmal gibt es auch vegetarische Thementage oder Tage, an welchen mit Alternativen gekocht wird.
Der Küche werden die Produkte jeden Tag frisch geliefert. So muss z. B. nichts nachreifen und auf den kurzen Transportwegen gehen keine Nährstoffe verloren. So werden diejenigen Lebensmittel verarbeitet, welche auf lokalem Weg verfügbar sind. Und die Herkunft der aufgetischten Produkte ist jederzeit nachvollziehbar.
Beispiels-Menü vom 16.4.2021
- Gebratene Hallwilersee Felchen
- Salzkartoffeln
- Gedünsteter Blattspinat
- Tartarsauce
- Salat und Dessert
- Langenthaler Leitungswasser


Die Mobile Akutbehandlung (moab) richtet sich an Patientinnen und Patienten ab 18 Jahren, welche sich in einer akuten psychischen Krise befinden und eine Behandlung im gewohnten Umfeld gegenüber einem stationären Aufenthalt vorziehen.
Seit einigen Jahren steigt der Bedarf an psychologischer und psychiatrischer Betreuung. Die Psychiatrischen Dienste SRO verfügen zurzeit über 34 stationäre Plätze, diverse ambulante Behandlungsmöglichkeiten sowie zwei Tageskliniken mit 12 resp. 14 Behandlungsplätzen. Weil die Psychiatrischen Dienste die gesamte Regi-on Oberaargau mit ihren rund 80 000 Einwohnern abdecken, übersteigt der tatsächliche Bedarf die vorhandenen Plätze.
Mobile Akutbehandlung schafft 16 zusätzliche Plätze
Um die Bedürfnisse der Patienten aus der Region besser abzudecken, haben die Psychiatrischen Dienste SRO das Modell Mobile Akutbehandlung (moab) lanciert. Dieses Modell ist andernorts unter dem Namen Home Treatment bekannt und wird in mehreren Regionen der Schweiz bereits erfolgreich angeboten. Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern hat 2018 die Durchführung von Modellver-suchen in drei Institutionen veranlasst. Eine davon sind die Psychiatrischen Dienste der SRO AG (Spital Region Oberaargau). Durch das Home Treatment-Modell werden im Oberaargau 16 weitere Behandlungsplät-ze für psychisch akut erkrankte Menschen geschaffen.
Individuellere Behandlung und Einbezug der Angehörigen
Die weiteren Vorteile dieser Behandlungsmethode erklärt Farida Irani wie folgt: «Wenn wir den Patienten zu Hause besuchen, sind wir Gast bei ihm. Diese Situation bestimmt von Anfang an den Umgang miteinander. Durch die Behandlung zu Hause sehen der Arzt und die Fachperson das direkte Umfeld des Patienten. So können wir die Behandlung noch spezifischer auf die Betroffenen ausrichten als bei einem stationären Aufenthalt.» Das Mittragen dieser Behandlungsform seitens der Angehörigen sei besonders wichtig. Diese würden durch die Betreuung entlastet und erhielten eine gewisse Sicherheit im Umgang mit den Patienten.
Tägliche Besuche
Im Oberaargau wohnhafte betroffene Personen werden von Pflegefachpersonen der Psychiatrie, Psycholo-gen und Ärzten zu Hause betreut. Die Fachperson besucht die Patienten während der Behandlung ein- bis mehrmals täglich. Bei Bedarf werden zusätzlich Sozialarbeitende einbezogen.
Für wen ist die Mobile Akutbehandlung nicht geeignet?
Menschen, bei welchen eine Abhängigkeits- oder Demenzproblematik vorliegt, die in der akuten Krise andere gefährden oder ein nicht einschätzbares Suizidrisiko haben, werden weiterhin stationär behandelt.




22 Paletten mit Medizingeräten nach Ghana verschifft
Monitore, Absaugpumpen, Spritzenpumpen, Beatmungsgeräte, ein Inkubator für Frühgeborene, Medikamentenwagen und Gebärbetten wurden vom Spital Region Oberaargau an ein Hilfsprojekt gespendet. In einer Wochenendaktion, zusammen mit dem Technischen Dienst der SRO AG Langenthal, wurden die Medizingeräte in selber gebauten Transportkisten, verpackt und in den Lastwagen verstaut der an die Nordseeküste fuhr.
«Wir hatten viele ausgemusterte Medizingeräte, die bei uns als «nicht mehr modern» gelten aber noch einwandfrei funktionieren. Da fing die Suche nach einer geeigneten Organisation an», erzählt Roger Giger, Ressortleitung Einkauf, Logistik und Medizintechnik der SRO AG. Diese Suche entpuppte sich als nicht ganz einfach. Denn viele Organisationen wollten nur einzelne Sachen und der Aufwand mit der Aussortierung hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen und einige Geräte wären übriggeblieben. Das Spital Langenthal suchte weiter.
Hospital St. Martin de Porres, Ghana
Dr. Bernward Steinhorst von der Helios-Klinik Cuxhaven war von seinen Freunden in Ghana, wo er seit Jahren ein katholisches Krankenhaus unterstützt, gebeten worden, sich um den Transport von Materialspenden aus der Schweiz nach Ghana zu kümmern. Ohne zu wissen, dass hieraus ein Riesenprojekt werden würde, sagte er zu und stellte dann fest, dass Jörg Ottensarendt, ein Freund seines Freundes, in der SRO AG als Stv. Chefarzt der Orthopädie arbeitete. Das sorgte für den Zündfunken, und die beiden Ärzte brachten dann das Projekt zusammen mit Roger Giger auf den Weg. Gerne wollte das Spital Langenthal das St. Martin de Porres Hospital in Eikwe im Westen Ghanas unterstützen. Letzteres betreut bis zu 200'000 Menschen und braucht für Ausrüstung und Investitionen noch regelmäßig Hilfe aus dem Ausland. Der Betrieb des Krankenhauses wird, bis auf eine deutsche Chirurgin, mit einheimischen Kräften und staatlichen Mitteln gewährleistet.
Vom Oberaargau nach Afrika
Alle noch gut brauchbaren Medizingeräte wurden an einem Januar-Wochenende im Spital Langenthal auf Funktion überprüft, verpackt und später auf den Lastwagen, eines mit dem gemeinsamen Freund der beiden Ärzte befreundeten Spediteurs, geladen, der das Material an die Nordseeküste fuhr. Am alten Fischereihafen in Cuxhaven wurde der erste Schiffscontainer mit den 22 Europaletten mit medizinischen Geräten aus dem Spital Region Oberaargau befüllt. Auch andere medizinische Güter von diversen deutschen Kliniken waren zwischendurch eingetroffen. Darunter auch eine komplette Röntgenanlage, die in Ghana wiederaufgebaut werden wird. Nebst dem wertvollem Krankenhausmaterial werden unter anderem auch Fahrräder und Bobby Cars von privaten Spendern als ‚Füllmaterial' zwischen den Kisten eingeladen. Danach ging es auf die drei Wochen lange Reise.
Inbetriebnahme in Ghana
Mit der Verschiffung ist es aber noch lange nicht getan. Der komplexeste und komplizierteste Teil ist der Wiederaufbau und die Inbetriebnahme, insbesondere des Röntgengerätes, im Spital in Ghana. Dafür hat die Cuxhavener Radiologie-Praxis einen Röntgenassistenten aus Ghana für ein dreiwöchiges Praktikum eingeflogen – Spenden ermöglichten die Reisekosten und das Visum. Einfach war die Einreise in dieser Pandemie-Zeit aber nicht. Auf das Argument, dass es gerade in Pandemie-Zeiten notwendig sei, die Gesundheitssysteme in Afrika zu stärken, stellte die Botschaft eines der derzeit selten erteilten Visa aus. Auch in Ghana sollte es möglich sein ein Röntgenbild einer Lunge zu machen, um eine Diagnose, z.B. Covid-19, stellen zu können.
Mitmachen begeistert
Die Monitore und Absaugpumpen aus Langenthal kamen sofort nach dem Auspacken des Containers - «es war wie Weihnachten» schrieb der Verwaltungsdirektor aus Eikwe - im neu eingerichteten Aufwachraum zum Einsatz. Dr. Bernward Steinhorst, der schon oft im OP in Eikwe gearbeitet hat, sagt dazu: «Durch diesen Aufwachraum, der mit der Lieferung aus der Schweiz in Betrieb genommen werden konnte, werden definitiv Leben gerettet, denn die unmittelbar postoperative Sterblichkeit dieser meist schwerkranken Patienten ist bisher zu hoch gewesen.» Der deutsche Chirurg, der gerade den zweiten Container im Hafen belädt, wo er die Zwischenräume mit Fußbällen und Trikots der örtlichen Vereine befüllt, ist tief bewegt, wie einfach es sei Menschen zum Mitmachen zu begeistern: «Es braucht wahrlich nicht viel, und sie springen auf diesen Zug auf. Es ist, als warteten sie nur auf eine Gelegenheit, sich zu engagieren. Die Welt ist also doch noch zu retten.»





Schon aus der Ferne erblickte man den XXL Kran der Firma Zaugg der am 18.01.2021 auf das SRO AG Gelände auffuhr. Grund: Der Betten-Pavillon, der während der Renovierungs- und Umbauarbeiten als Ausweichstation diente, wird nun in den nächsten Tagen komplett rückgebaut.
Schicht für Schicht der Wände und Decken schweben an den starken Seilen des über 200 Tonnen schweren Krans über das Spitalareal. Das provisorische Gebäude mit den 11 Patientenzimmern, 22 Betten und der ganzen Infrastruktur wird nun rückgebaut. Ganze fünf Jahre lang diente der Pavillon als Ausweichstation.
Zuerst wurde anfangs 2016 das Haus Süd (Frauenklinik, Onkologie und Intensivstation) umgebaut, im Jahre 2018 folgte die umfassende Renovation des Bettenhochhauses, dieser sportliche Zeitplan konnte exakt eingehalten werden. Anstelle des Pavillons, zwischen der Stationären Psychiatrie und dem Ärztehaus 1, werden danach wieder Rasen und Blumen das Areal begrünen.
Bettenhochaus erstrahlt in neuem Glanz
Nach einer über zweijährigen intensiven Bauzeit (Mai 2018 bis November 2020) ist es soweit – das Betten-hochhaus erstrahlt in neuem Glanz. Die Infrastruktur konnte modernisiert und so die Betriebsabläufe optimiert werden. Während den Bauarbeiten wurden grosse Anstrengungen unternommen um die Beeinträchtigungen und Lärmbelästigungen der Patienten so gering wie möglich zu halten. Nun erfreut sich die SRO AG an den schönen 1er- und 2-er-Zimmer und an der Urologie-Praxis im 9. OG und vor allem daran, den Patientinnen und Patienten den Aufenthalt angenehm und zeitgemäss zu gestalten.
Die Spital Region Oberaargau (SRO) rüstet sich für die Zukunft. Im Fokus steht dabei die künftige, engere Zusammenarbeit mit der Regional Spital Emmental AG. Als Basis für das nähere Zusammenrücken der beiden Spitäler dient die vom Regierungsrat 2021 beschlossene Spitalversorgungsstrategie im Rahmen des «4+-Regionen-Modells». Befürchtungen, dass beim SRO-Spital in Langenthal deswegen ein massiver Abbau droht, tritt Direktor Andreas Kohli im Gespräch mit dem «Unter-Emmentaler» entschieden entgegen: «In Langenthal wird es auch künftig ein qualitativ erstklassiges Spital-Angebot geben, verbunden mit einer Notfallstation.»
Walter Ryser
Langenthal - Die Situation bei vielen Spitälern in der Schweiz ist prekär. Sie kämpfen mit einer ungenügenden Rentabilität, vor allem jene Spitäler, die in der Grundversorgung tätig sind. Mit der Umsetzung des sogenannten «4+-Regionen-Modells» wird im Kanton Bern versucht, diese unbefriedigende Situation nachhaltig zu entschärfen. Mit dem Modell wird eine engere Zusammenarbeit unter den Spitälern angestrebt, sollen Angebot und Dienstleistungen besser koordiniert und das vorhandene Synergie-Potenzial genutzt werden.
Kein Spital-Abbau geplant
Andreas Kohli, Direktor der Spital Region Oberaargau (SRO) in Langenthal, bestätigte gegenüber dem «Unter-Emmentaler», dass sich sein Unternehmen mitten in diesem Prozess befindet: «Verwaltungsrat und Direktion sind intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Wir suchen entsprechende Wege, wie wir mit unserem Unternehmen in die Zukunft gehen wollen und auch können.» Aus diesem Grunde habe man den Kontakt mit der Regional Spital Emmental AG in Burgdorf auf verschiedenen Ebenen intensiviert und diverse Arbeitsgruppen gebildet. Bereits habe man sich auf ein gemeinsames Zielbild geeinigt und in ersten Fachbereichen Kooperationen etabliert, erwähnt Andreas Kohli. Aktuell sei man daran, zu prüfen, in welchen weiteren Themen eine engere Zusammenarbeit Sinn mache und beiden Spitälern einen Mehrwert verschaffe. Kohli betont explizit, dass im Zentrum dieses Prozesses der Erhalt der Grundversorgung für die Bevölkerung in beiden Regionen stehe, verbunden mit Notfallstationen an den Standorten in Langenthal, Burgdorf und Langnau. Damit entkräftet der SRO-Spitaldirektor Befürchtungen nach einem massiven Spital-Abbau in Langenthal, die zuletzt in der Region Oberaargau aufkamen.
Ambulantisierung vorantreiben
Andreas Kohli ist überzeugt, dass es in Langenthal auch künftig ein erstklassiges Spital-Angebot samt Notfallstation geben wird. Dabei verweist er auf die aktuelle Situation bei den Spitälern in Burgdorf und Langenthal, die beide praktisch voll belastet seien, weshalb momentan keinerlei Verschiebe-Potenzial in nur eine Richtung bestehe, weder bei den Patienten noch bei Angeboten und Dienstleistungen. Im Gegenteil, immer wieder komme es vor, dass man Probleme mit Überbelegungen habe und bei der Suche nach geeigneten Betten in anderen Spitälern oft vor «verschlossenen Türen» stehe. So habe man erst kürzlich bei nicht weniger als 15 Spitälern nachgefragt, um zwei Patienten platzieren zu können. Letztendlich sei man dann in Menziken und Aarberg doch noch fündig geworden. Auch die Zahlen bei den Notfällen sprechen gemäss Kohli ganz klar gegen einen Abbau oder eine Verlegung der Notfallstation, mussten doch in Langenthal im letzten Jahr nicht weniger als 30 000 Notfälle behandelt werden. Dennoch befürwortet Andreas Kohli das angestrebte «4+-Regionen-Modell». Für die beiden Spitäler in Langenthal und Burgdorf sieht der SRO-Spitaldirektor durchaus Synergie-Potenzial, vorab in den Bereichen Einkauf, IT oder HR (Personalrekrutierung). Daneben gelte es aber auch andere Modelle und Wege zu prüfen, um die aktuell unbefriedigende Situation bei den Spitälern und im gesamten Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen. Grosses Potenzial sieht Kohli diesbezüglich im Bereich einer vermehrten Ambulantisierung, das seiner Meinung nach nun gezielt ausgeschöpft werden sollte. Der erste Schritt in diese Richtung wurde am 24. November 2024 mit der Annahme der Volksabstimmung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der ambulanten und stationären Leistungen) umgesetzt. Auch bei den Psychiatrischen Diensten sieht er Möglichkeiten zur Optimierung des Angebotes. Anstatt weitere Betten zu schaffen und zu betreiben, ziele man darauf ab, künftig vermehrt Patienten zu Hause aufzusuchen und mit entsprechenden Fachleuten extern zu behandeln, sofern dies das Krankheitsbild der zu behandelnden Personen zulasse.
Nicht zu viele Spitalbetten
Andreas Kohli wehrt sich auch gegen die oft geäusserte Kritik, dass die Schweiz über zu viele Spitalbetten verfüge. Der 63-jährige Aarwanger sagt dazu, dass man in der Schweiz nicht grundsätzlich zu viele Spitalbetten habe, diese würden aber wohl nicht immer am richtigen Ort und wohl auch teilweise in zu kleinen Spitälern liegen. Die Frage stelle sich vielmehr, welche Leistungen in den einzelnen Spitälern angeboten würden. Deshalb glaubt er, dass Kliniken und Spitäler in Zukunft weiter zusammenwachsen werden. Als Beispiel dafür nennt er die Rettungsdienste Emmental-Oberaargau, die bereits zusammengelegt wurden und gemeinsam funktionieren. Der Umbau der Spitallandschaft auch in unserer Region werde noch eine Weile dauern, dämpft Kohli die Erwartungen. Er weist darauf hin, dass es hier um komplexe Prozesse gehe, die neben dem Tagesgeschäft bewältigt werden müssen. Das sei sehr anspruchsvoll und erfordere viel Zeit und Personalressourcen.
Daneben sei man gefordert, die laufenden Prozesse zu überprüfen und zu verbessern. Hier sei man bei der SRO AG auf gutem Weg, betonte Andreas Kohli und weist darauf hin, dass es gelungen sei, das finanzielle Ergebnis im vergangenen Jahr deutlich zu verbessern. Dennoch befinde man sich nach wie vor, so wie die meisten anderen Spitäler ebenfalls, in der Verlustzone, relativiert der Spitaldirektor die Jahreszahlen, die in den nächsten Wochen präsentiert werden. Auch bei einem anderen Thema hat die SRO AG laut seinem Direktor Fortschritte erzielt. Gemäss einer Klage von verschiedenen Krankenkassen beim Schiedsgericht des kantonalen Verwaltungsgerichts soll die SRO AG von 2019 bis 2023 Medikamentenvergünstigungen nicht korrekt an die Patientinnen und Patienten weitergegeben haben (der «Unter-Emmentaler») berichtete.
Mit Krankenkassen Einigung erzielen
Andreas Kohli nimmt dazu Stellung und präzisiert: «Es handelt sich hier um ein schweizweites Thema, bei welchem bei Weitem nicht nur die SRO AG betroffen ist. Beim Einkauf von Medikamenten erhält man je nach bestellter Menge gewisse Rabatte. Für die Verwendung dieser Rabatte gibt es klare Richtlinien. So muss lediglich ein Teil dieser Rabatte den Patienten weitergegeben werden, mit dem anderen Teil finanzieren die Spitäler erforderliche Qualitätsmassnahmen.» Man habe sich mit der Forderung der Krankenkassen auseinandergesetzt. Dabei habe man sich mit etlichen von ihnen einigen können, mit anderen befinde man sich noch in Verhandlung, gab Andreas Kohli zu verstehen.
Neues Angebot: Gesundheitsnetzwerk Oberaargau
Die Gesundheitsstrategie des Kantons Bern 2020 bis 2030 sieht im Bereich integrierter Versorgung die ganzheitliche Koordination und Optimierung der Gesundheitsleistungen zwischen den verschiedenen Leistungserbringern wie Langzeitpflege, Spitex-Organisationen, Spitälern und Ärzten vor. Überflüssige Behandlungen und Doppelspurigkeiten in der Behandlung von Patienten sollen damit minimiert werden. Mit dem geplanten Gesundheitsnetzwerk Oberaargau soll ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung unternommen werden, wie SRO-Direktor Andreas Kohli zu verstehen gibt. Dieses Netzwerk ist laut Kohli Teil der neuen «Versorgungsregion Emmental-Oberaargau». «In einer ersten Phase übernimmt die SRO AG mit der doa AG (dahlia oberaargau ag), der «SGOL» (Spitex Genossenschaft Oberaargau Land) und der Spitex ola AG (Spitex Oberes Langetental AG) die Federführung für den Aufbau des Gesundheitsnetzwerks Oberaargau. Im Zentrum steht dabei der Aufbau einer gemeinsamen sozialmedizinischen Koordinationsstelle (Case Management) mit Fokus auf komplexe/chronische Kundensituationen. Als weitere Themen könnten unter anderem die Demenz sowie die Psychiatrischen Leistungen dazukommen.
Das Gesundheitswesen der Regionen Emmental und Oberaargau braucht Ideen und Lösungen
Im Bereich Gesundheit wollen die Regionen Emmental und Oberaargau konkrete Synergien schaffen. Dies soll nicht nur die explodierenden Gesundheitskosten senken, sondern den Patientinnen und Patienten in allen Bereichen die bestmögliche Versorgung sicherstellen. Das gehört zur Strategie einer noch besseren Gesundheitsversorgung des Kantons Bern. Klar definierte Ziele sind, aufeinander zuzugehen und Fachwissen, Methoden und Versorgungsabläufe auszutauschen.
In allen Bereichen und auf allen Stufen des Gesundheitswesens sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren können. Am 19. November 2024 erläuterten im Saalbau Kirchberg Referentinnen und Referenten anlässlich des Symposiums mögliche Chancen und Herausforderungen einer Zusammenarbeit zwischen der Spital Emmental AG und der SRO AG, Spital Region Oberaargau.
«Gemeinsam sind wir stark – Transformation im Gesundheitswesen»
Der Einladung zum Symposium «Gemeinsam sind wir stark – Transformation im Gesundheitswesen» folgten rund 170 Interessierte. Die Spital Emmental AG und die SRO AG, Spital Region Oberaargau, organisierten nach dem letztjährigen bereits das zweite gemeinsame Symposium. Vertreterinnen und Vertreter der beiden Spitäler, des Gesundheitswesens sowie der Politik aus dem Oberaargau und dem Emmental waren unter den Gästen.
In verschiedenen Referaten wurden Projekte ausführlich vorgestellt, die Zukunftsperspektiven und mögliche Netzwerke der verschiedenen Gesundheitsfachleute aufzeigen. Die Versorgungsregion Emmental und Oberaargau erreicht durch einen Zusammenschluss generell einen Angebotsaufschwung, nicht nur durch ein effizienteres Spitalleistungsangebot, sondern auch durch die Spitex-Organisationen – neben anderen Leistungserbringern –, die einen wichtigen Versorgungssektor ausfüllen. Die Ausarbeitung einer regionalen Zusammenarbeit und deren Betrieb sind Teil der Umsetzung. Arbeitsgruppen der Spital Emmental AG und der SRO AG, Spital Region Oberaargau, sind aktuell am Eruieren konkreter Lösungs- und Leistungswege.
Interessante Referate und eine zielgerichtete Podiumsdiskussion
Nach der Begrüssung und Einleitung gab Daniel Schmid, Verwaltungsratspräsident Spital Region Oberaargau, das Mikrofon an Moderatorin Nadine Brönnimann weiter. Die vier Referate wiederum eröffnete Alessia Schrepfer, diplomierte Pflegefachfrau FH und Jung unternehmerin des Jahres 2024. Sie ist Mitgründerin der WeNurse AG, einem innovativen Unternehmen im Gesundheitswesen. Alessia Schrepfer präsentierte ihren Weg zum Erfolg: Mitarbeiter/innen richtig auswählen und einsetzen, fördern und stärken und alte Hierarchien überdenken – einfache Ansätze, aber harte Arbeit. Mucksmäuschenstill wurde es im Saal beim Referat von Verena Zimmermann, Vize-Verwaltungsratspräsidentin der mpdEO AG (Mobiler Palliativdienst Emmental-Oberaargau) und Geschäftsführerin der Spitex Oberaargau AG. Sie beeindruckte mit ihrem Referat «Zwischen Leben und Sterben ».
Die Spitex bietet die Grundpflege zu Hause. Die mpdEO AG setzt sich für Menschen mit lebenslimitierenden Erkrankungen ein. In Kooperation bieten beide Organisationen die würdige Pflege und Betreuung für Lebensqualität bis zum nahen Lebensende. Den dritten Kurzvortrag übernahm ziemlich spontan Regula Feldmann (Geschäftsführerin Spital Emmental), da Dr. med. Urspeter Knecht, Chefarzt und Leiter des Instituts für Radiologie und Neuroradiologie, Spital Emmental, wegen Krankheit leider nicht anwesend sein konnte. Regula Feldmann gab anhand der Radiologie einen Einblick in die strategische Ausrichtung und die vorhandenen Netzwerke in öffentlichen Spitälern. Wenn der Postmann zweimal klingelt, wissen wir, was läuft. Was passiert aber, wenn ein Psychiatrie-Team zu Hause klingelt? Dr. med. Manuel Moser (Stv. Ärztlicher Direktor und Chefarzt Psychiatrische Dienste, SRO AG) erläuterte in seinem Part genau diese Frage.
Ein absolut innovativer Vorgang stellt die mobile Akutbehandlung des Psychiatrie-Teams dar. Im Zuge der Zeit sind die stationären Behandlungen heute mehr und mehr überlastet. Zur Entlastung sind seit 2020 Pilotprojekte im Gange, die auf ziemlich allen Ebenen klare Erfolge zeigen. So werden heute stationär behandlungsbedürftige Menschen, wo möglich, in ihrem eigenen Zuhause behandelt. In der anschliessenden Podiumsdiskussion, der sich zwei weitere Diskussionspartner anschlossen – Prof. Dr. med. Beat Müller, ehemaliger Chefarzt, seit 2024 Verwaltungsratsmitglied Spital Emmental sowie Gründer einer Beratungsfirma für ein nachhaltiges Gesundheitswesen, und Hansjörg Lüthi, Geschäftsführer Haslibrunnen Langenthal, dem Kompetenzzentrum für das Alter –, wurden diese Themen vertieft. Weiter wurde über Veränderungen im Gesundheitswesen diskutiert.
Wie also könnte die Zukunft im Bereich Gesundheit in den Regionen Emmental und Oberaargau aussehen? Eine gemeinsame Quintessenz lässt sich unschwer festhalten: Gemeinsam sind wir stark, Brücken bauen, «lifere u nid lafere» – so der Tenor des zweiten Symposiums der Spital Emmental AG und der SRO AG, Spital Region Oberaargau. Bereits ist mit dem neuen Brustzentrum Emmental-Oberaargau an den beiden Standorten Burgdorf und Langenthal ein synergetisch sinnvolles und wegweisendes Leistungsangebot entstanden, ebenso ein weiteres wirkungsvolles Zusammenspiel mit der Rettungsdienst Emmental-Oberaargau AG. Den Abschluss machte Bernhard Antener, Verwaltungsratspräsident Spital Emmental. Er betonte, dass dem Fachkräftemangel und Kostendruck auch in den nächsten Jahren nur schwer beizukommen sein werde. Zielführender sei es deshalb, selber aktiv zu werden, vorauszudenken und auf dem Vorhandenen aufzubauen.
© D'Region
In einem Vortrag erläutern Fachpersonen, welche Symptome auf Brustkrebs hindeuten und wie die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen behandelt wird.
Dank Früherkennung und besseren Behandlungsmöglichkeiten haben sich die Heilungschancen bei Brustkrebs enorm verbessert. Entscheidend ist die interdisziplinäre Behandlung an einem Brustzentrum, wo verschiedene Fachrichtungen Hand in Hand zusammenarbeiten. Seit Anfang Jahr führen das Spital Emmental und das Spital Region Oberaargau (SRO) ein gemeinsames Brustzentrum mit zwei Standorten. In ihrem Vortrag am Donnerstag, 17. Oktober 2024, zeigen die Spezialistinnen und Spezialisten des Brustzentrums Emmental-Oberaargau auf, welche Fachpersonen in die Behandlung von Brustkrebs involviert sind, welche vielfältigen Therapiemethoden zur Verfügung stehen und wie die Erkrankten vor, während und nach der Behandlung unterstützt werden. Dr. med. Thomas Eggimann, Standortleiter Burgdorf und stellvertretender Chefarzt der Frauenklinik des Spitals Emmental, und Dr. med. Daniele Bolla, Standortleiterleiter Langenthal und Chefarzt Frauenklinik SRO, geben im Interview Auskunft zu ihrer Zusammenarbeit und zeigen auf, wie vielfältig die modernen Behandlungsmethoden sind.
«D’REGION»: Seit einigen Monaten betreiben die beiden Frauenkliniken in Burgdorf und Langenthal das Brustzentrum Emmental-Oberaargau, um Patientinnen mit Brustkrebs eine wohnortsnahe Betreuung zu bieten. Mit welcher Absicht geschieht das?
Daniele Bolla: Das Ziel ist es, die jahrelangen Erfahrungen und das Knowhow der Spezialistinnen und Spezialisten beider Spitäler zusammenzuführen. Das fördert den Austausch und sorgt an zwei Standorten für die bestmögliche Qualität in der Brustkrebsbehandlung. Davon profitieren unsere gemeinsamen Patientinnen.
Thomas Eggimann: Wenn man die Krankheit von Anfang an interdisziplinär angeht, wirkt sich das positiv auf die Behandlungsqualität und die langfristige Genesung aus. Das zeigen die Erfahrungen zertifizierter Brustzentren.
«D’REGION»: Wie genau sieht die Zusammenarbeit aus?
Daniele Bolla: Wir untersuchen die Patientinnen an einem der beiden wohnortsnahen Standorte und versuchen, möglichst rasch zu einer Diagnose und zur passenden Behandlung zu kommen. Sämtliche Fälle besprechen wir am Tumorboard mit Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Onkologie, Radiologie, Radio-Onkologie, Pathologie und bei Bedarf plastischer Chirurgie, um gemeinsame Behandlungsstrategien zu definieren. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein grosser Mehrwert des Brustzentrums.
Thomas Eggimann: Wenn eine Frau bei sich einen möglichen Brustkrebs entdeckt, kommt häufig grosse Angst auf. Deshalb ist es wichtig, dass wir rasch einen Termin zur Abklärung anbieten können. Erhärtet sich der Verdacht, haben wir mit dem Brustzentrum die Möglichkeit, Patientinnen an beiden Standorten engmaschig zu begleiten.
«D’REGION»: Welche frühen Anzeichen und Symptome deuten auf Brustkrebs hin und wie können Frauen diese selbst erkennen?
Daniele Bolla: Brustkrebs bereitet am Anfang leider keine Beschwerden. Mögliche bösartige Veränderungen können durch die regelmässige Selbstuntersuchung der Brust festgestellt werden. Bei Frauen mit Regelblutungen ist der beste Zeitpunkt in den ersten Tagen nach der Periode. Frauen nach der Menopause sollten sich selbst einen festen Termin alle vier Wochen setzen. Mögliche Anzeichen für einen bösartigen Tumor in der Brust können sein: plötzlich auftretende Knoten und Verhärtungen (selten verbunden mit Schmerzen), Veränderungen an der Haut oder der Brustwarze, Rötungen, plötzliche Grössenunterschiede oder Unterschiede im Aussehen der Brüste, tastbare Lymphknoten in der Achselhöhle oder Ausfluss aus einer Brustwarze. Wenn Sie eines dieser Symptome bemerken, ist es ratsam, sich im Spital abklären zu lassen. Die senologischen Voruntersuchungen (Praxis/ Spital) bleiben weiterhin ein wichtiger Bestandteil zur Erkennung und Behandlung von Brusterkrankungen.
«D’REGION»: Welche Behandlungsmöglichkeiten für Brustkrebs stehen derzeit zur Verfügung?
Thomas Eggimann: Früher gab es fast nur die Chirurgie zur Behandlung der Krankheit, oft eine komplette Brustentfernung. Heute gibt es viele medikamentöse Therapien wie Immuntherapie, Hormontherapie oder Chemotherapie. Im Vergleich zu früher haben heute viele Brustkrebspatientinnen gute Heilungschancen.
«D’REGION»: Wie wird entschieden, welche Methode die richtige für eine Patientin ist?
Thomas Eggimann: Am interdisziplinären Tumorboard, das wir gemeinsam einmal pro Woche durchführen, werden die Behandlungsempfehlungen gemeinsam festgelegt. Dabei sind Tumortyp und -grösse, Alter der Patientin und allfällige Zusatzbefunde und Nebendiagnosen entscheidend, um ein individuelles Therapiekonzept zu erarbeiten. Die Empfehlungen werden den Betroffenen ausführlich erklärt und begründet. Die Patientinnen entscheiden danach, ob sie den Empfehlungen folgen wollen. Aus Erfahrung tun das die allermeisten, aber es gibt immer mal wieder Betroffene, die einen abweichenden Weg bevorzugen. Wir begleiten diese Frauen genauso gut und engmaschig.
«D’REGION»: Welche Nebenwirkungen haben diese Therapien?
Daniele Bolla: Je nach Therapie kann es beispielsweise zu Gelenkbeschwerden oder Hitzewallungen kommen. Aber das hängt von vielen Faktoren wie vom Alter oder dem Stadium der Krankheit ab. Haarausfall, Übelkeit, Erschöpfung – die stärksten Nebenwirkungen hat die Chemotherapie. Aber auch diese Nebenwirkungen können gelindert werden.
Thomas Eggimann: Trotz der meist nur wenigen Nebenwirkungen: So eine Therapie ist kein Zuckerschlecken. Brustkrebs bringt viele Herausforderungen mit sich für die Betroffenen und deren Familien. Es braucht Ausdauer und Geduld. Da ist es wichtig, dass die Patientinnen optimal betreut und begleitet werden – nicht nur von uns Ärztinnen und Ärzten, sondern auch vom speziell ausgebildeten Pflegepersonal.
«D’REGION»: Welche praktischen Tipps haben Sie für Brustkrebspatientinnen, um die Behandlung und den Alltag besser zu bewältigen?
Daniele Bolla: Leider gibt es keine allgemeine Strategie oder ein Rezept, wie Brustkrebspatientinnen sich am besten verhalten sollen, um die Behandlung und den Alltag besser zu bewältigen. Wichtig ist, sich nicht zurückzuziehen: Sie sind nicht alleine – tauschen Sie sich aus, suchen Sie sich Unterstützung bei Ihren Freunden und Ihrer Familie. Auch Ihr Brustteam ist stets für Sie da.
Thomas Eggimann: Nehmen Sie sich Zeit für sich, lassen Sie sich nicht drängen und versuchen Sie, Dinge zu tun, die Ihnen guttun. Sport und eine ausgewogene Ernährung tragen zum Wohlbefinden bei, stärken das Immunsystem und können den Verlauf einer Krebserkrankung positiv beeinflussen. zvg
Vortrag Burgdorf: Donnerstag, 17. Oktober 2024, 19.00 Uhr (Kurslokal Spital Emmental, Oberburgstrasse 54, EG)
Vortrag Langenthal: Mittwoch, 30. Oktober 2024, 19.00 Uhr (im Haslibrunnen, Untersteckholzstrasse 1)

Kernmitglieder des Brustzentrums: Dr. med. Thomas Eggimann, stv. Chefarzt Frauenklinik Spital Emmental (links), und Dr. med. Daniele Bolla, Chefarzt Frauenklinik SRO.
In der Ära der Digitalisierung erleben wir, wie innovative Technologien den medizinischen Sektor transformieren. Bereits 2019 berichteten wir über die innovative Einführung des papierlosen Materialmanagements im Spital Region Oberaargau (SRO) in Langenthal. Heute steht die SRO AG erneut im Rampenlicht mit einer revolutionären Weiterentwicklung: MEDIC, ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes System, das den gesamten Prozess der Operationsvorbereitung neu definiert. In unserem Gespräch mit Timo Thimm, dem Leiter medizintechnische Dienste, René Furer, dem Leiter Einkauf und Logistik, sowie Torsten Förster von Consight tauchen wir in die Funktionsweise und die transformative Wirkung von MEDIC ein.
Was sind die aktuellen Herausforderungen im OP-Management?
Timo Thimm: Die gegenwärtigen Herausforderungen im OP-Management sowie in anderen Berufsfeldern liegen im Umgang mit dem Mangel an Mitarbeitenden. Dieses Problem wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Eine zentrale Aufgabe besteht darin, neue Berufsbilder erfolgreich in den Operationsbetrieb zu integrieren.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei?
Timo Thimm: Die Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle in dieser Situation. Seit 2019 arbeiten wir aktiv an Lösungen, die nicht darauf abzielen, Mitarbeitende zu ersetzen, sondern die Aufgaben effizienter zu verteilen. Durch unsere digitalen Lösungen haben wir sogar die Möglichkeit geschaffen, Mitarbeitende mit einem Pensum von nur 5 Prozent im OP-Betrieb zu beschäftigen. Die Digitalisierung ist der Schlüssel, da sie den Mitarbeitenden alle notwendigen Informationen zum Zeitpunkt der Operation bereitstellt. Zusätzlich konnte durch die digitale Verwaltung des Logistiksystems der gesamte Rüstprozess an Mitarbeitende der OP-Logistik übertragen werden.
Was bedeutet das für die Spitallogistik?
René Furer: Wir können nun die Bestände und den Verbrauch in der Spitallogistik viel genauer auf die Bedürfnisse der Operationen abstimmen. Das führt nicht nur zu einer effizienteren und kostengünstigeren Lagerhaltung, sondern ermöglicht es der Logistik auch, den gesamten Materialfluss für die chirurgischen Eingriffe zu übernehmen. Dadurch können wir das OP-Personal entlasten, sodass sie sich mehr auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können.

Torsten Förster und Timo Thimm (v. l. n. r.)
Und wie ist dann MEDIC entstanden?
Torsten Förster: MEDIC ist das Ergebnis hervorragender Teamarbeit mit den Kollegen des SRO. Wir haben regelmässig zusammengefunden, Ideen geteilt und weiterentwickelt, umgesetzt und wieder evaluiert – und das über einige Monate hinweg. Schliesslich erreichten wir den Punkt, an dem wir entschieden haben, es ist Zeit für die Einführung. Aber es gibt noch viele Ideen für weitere Schritte.
Können Sie uns kurz erläutern, was das System im Kern macht?
Torsten Förster: Im Kern ist MEDIC ein System, das den gesamten Prozess rund um die Operationen unterstützt. Es beginnt mit einer detaillierten Analyse der für jede OP erforderlichen Materialien und Prozeduren. MEDIC generiert für jede OP spezifische Anweisungen und eine Liste von Materialien, basierend auf dem Wissen der Organisation. Darüber hinaus orchestriert MEDIC die Logistik hinter den Kulissen. Es koordiniert die Vorbereitung und übernimmt die Nacharbeiten.
Und wie läuft es?
René Furer: Wir sind sehr zufrieden. Durch die wichtigen Inputs der OP-Logistiker konnten die Anforderungen/Themen rasch aufgenommen, umgesetzt und optimiert werden.
Was bedeutet das für Ihre Mitarbeitenden?
René Furer: Die Mitarbeitenden werden vermehrt als Fachpersonen für die Logistik und als wichtiger Dienstleister wahrgenommen. Ich stelle fest, dass sie dadurch an Selbstvertrauen gewonnen haben und den Mitarbeitenden im OP auf Augenhöhe begegnen. Zudem profitieren sie von den vereinfachten, effizienten Abläufen.
Wie profitieren die Patienten?
Timo Thimm: Patienten können von einer verbesserten Operationsvorbereitung in Form von erhöhter Sicherheit, geringeren Komplikationsraten und schnellerer Behandlung profitieren – trotz knapper Personalressourcen.
Torsten Förster: Zum einen gewährleistet das System, dass jede Operation unter optimalen Bedingungen stattfindet, unabhängig davon, wer die Vorbereitung durchführt. Zum anderen ermöglicht die hohe Effizienz und Geschwindigkeit eine schnellere Bearbeitung der Operationswartelisten. Eine schnellere Behandlung kann den Heilungsprozess beschleunigen.
Und was bewirkt der Einsatz künstlicher Intelligenz?
Torsten Förster: Vereinfacht gesagt sorgt KI in der OP-Vorbereitung dafür, dass jeder so effizient agiert, als wäre er der beste Spezialist für die Vorbereitung dieser OP.
Können andere Spitäler von den Erfahrungen der SRO AG profitieren?
René Furer: Natürlich, wir sind offen, unsere Erfahrungen auch weiterzugeben, und hatten diesbezüglich auch bereits Besuche bei uns im SRO.
Torsten Förster: Auf unserer neuen Website (www.consight-swiss.ch) werden wir ab Mai einen Bereich einrichten, wo die wichtigsten MEDIC-Funktionen direkt auf der Website ausprobiert werden können. Darüber hinaus gibt es Videos, welche die Funktionen veranschaulichen. Wer mehr wissen will, kann im eigenen Haus erproben.
Was möchten Sie unseren Lesern raten, die sich mit der Digitalisierung des OP-Managements beschäftigen?
Timo Thimm: Entscheidend ist, alte Gewohnheiten abzulegen. Die aktuelle Lage fordert uns auf, neu zu denken – das gilt besonders für die Digitalisierung. Effektive Digitalisierung erfordert Offenheit für deren Möglichkeiten. Wer sich zu sehr in der Optimierung von Einzelprozessen verfängt, verpasst das grössere Bild. Wichtig ist, offen für Veränderungen zu sein und dies auch wirklich umzusetzen, nicht nur in Worten.
René Furer: Die bisherigen Prozesse sind zu hinterfragen, und an alten, festgefahrenen Abläufen sollte man nicht um jeden Preis festhalten. Die Zusammenarbeit im Team ist das entscheidende Erfolgsrezept.
© Heime & Spitäler

«Die Zusammenarbeit im Team ist das entscheidende Erfolgsrezept.»
Ein Teil des OP-Logistikteams: Lara Leu, Manuel Beutler, René Furer, Christoph Althaus (v. l. n. r.)
Essen sollte eine genussvolle und wohltuende Aktivität sein – jedoch sieht die Realität oft anders aus. Dr. med. Bettina Isenschmid, MME und Chefärztin ZESA (Zentrum für Essstörungen und Adipositas) der Spital Region Oberaargau AG, erklärt, wie es zu Essstörungen kommen kann und worauf man unbedingt Acht geben sollte.
Frau Isenschmid, was sind die häufigsten Arten von Essstörungen und wie unterscheiden sie sich voneinander?
Die häufigsten Essstörungsformen sind die Bulimie und die Binge-Eating-Störung. Bei der Bulimie handelt es sich um eine Essstörung, welche durch regelmässig wiederkehrende Essattacken mit nachfolgendem Kompensationsverhalten gekennzeichnet ist. Das häufigste Kompensationsverhalten ist Erbrechen – es kann jedoch auch zum Missbrauch von Abführmitteln, kürzeren strikten Fastenphasen oder übermässigem Training kommen.
Und was versteht man unter Binge-Eating?
Bei der Binge-Eating-Störung kommt es zu wiederkehrenden Essattacken mit dem Gefühl eines Kontrollverlustes, es fehlt jedoch das Kompensationsverhalten. Daher kommt es mittel- und längerfristig zu einer Gewichtszunahme bis hin zur Adipositas.
Gib es noch weitere Formen?
Als dritte und seltenste Essstörungsform kennen wir noch die Anorexia nervosa, zu Deutsch Magersucht, welche vor allem im Jugendalter auftritt. Wesentliche Kriterien der Anorexie sind striktes Fasten und damit ein selbst herbeigeführter Gewichtsverlust bis zum Untergewicht.
Welche Faktoren können zu einer Essstörung führen?
Essstörungen sind nie nur durch einen einzigen Faktor verursacht. Zu nennen ist eine genetische Grundlage mit Unterschieden im Energiehaushalt und im Hunger- und Sättigungsempfinden. Weiter sind es gewisse psychologische Voraussetzungen wie hoher Leistungswille, Perfektionismus sowie Schwierigkeiten, Gefühle angemessen wahrzunehmen und auszudrücken. Hinzu kommen eine eher ängstlich geprägte Gefühlsvermeidung sowie schlussendlich soziale Faktoren wie Gewalt und Missbrauch in der Vergangenheit, widersprüchliche Leistungsanforderungen unserer Gesellschaft sowie ungesunde Rollenvorbilder wie Schönheits-, Schlankheits- und Leistungsideale.
Gibt es weitere Faktoren?
Vor allem im Bereich des Binge-Eating und der Adipositas sind auch ungünstige Lebensbedingungen wie Verringerung der körperlichen Aktivität sowie das Übermass an Nahrungsangeboten mit verantwortlich.
Wie erkennt man, ob jemand an einer Essstörung leidet und welche Anzeichen sollte man beachten?
Allen Essstörungen gemeinsam ist die ständige gedankliche und verhaltensmässige Beschäftigung mit Essen, Ernährung, Figur und Gewicht. Es werden starke Gewichtsschwankungen von Untergewicht über Normalgewicht bis Übergewicht beobachtet. Die Betroffenen sind ständig daran, irgend eine Diät zu halten, kritisieren sich selbst – auch unabhängig vom Gewicht – für ihr Aussehen, beginnen, soziale Gelegenheiten zu meiden, die mit Essen verbunden sind, schliesslich sind die Themen Essen und Gewicht so vorherrschend geworden, dass sich Betroffene anderen Interessen nicht mehr annehmen können und sich z. B. von Beziehungen, Arbeit oder Ausbildung immer mehr zurückziehen. Hierdurch kommt es auch zu körperlichen Auswirkungen der Essstörung im Sinne einer Fehl- oder Mangelernährung.
Welche Auswirkungen haben Essstörungen auf die körperliche Gesundheit?
Unser Körper ist allgemein sehr widerstandsfähig, da in der früheren Zeit der Menschheitsgeschichte die Mangelernährung eigentlich fast unvermeidlich war. Bei einem längeren Andauern des Zustandes versucht jedoch der Körper, Energie einzusparen, indem er den Puls verlangsamt sowie den Blutdruck und die Körpertemperatur senkt. Infolge von ungenügendem Essen, Erbrechen oder Missbrauch von Abführmitteln kommt es zu hartnäckigen Verdauungsproblemen wie Blähungen, saurem Aufstossen, Bauchschmerzen und Stuhlunregelmässigkeiten.
Was passiert, wenn jemand regelmässig erbricht?
Durch das Erbrechen gehen wertvolle Mineralstoffe verloren, die dann zu einer Beeinträchtigung der Herz- oder Nierenfunktion und in gewissen Fällen sogar zum Tod führen können. Längerfristig leidet auch unser Skelett darunter, es kommt zur Ausbildung einer Osteoporose, und der Hormonmangel führt zu Fruchtbarkeitsstörungen.
Wie beeinflussen Essstörungen die psychische Gesundheit und das emotionale Wohlbefinden der Betroffenen?
Die Betroffenen sind eigentlich ständig besorgt um ihre Figur, ihr Gewicht und ihr Essverhalten. Sie wirken daher gehemmt, ängstlich, zeitweise niedergeschlagen oder auch depressiv. Die Betroffenen werten sich ständig für ihr Essverhalten und ihre Figur ab, versuchen dies durch noch striktere Diät zu halten oder durch noch mehr Körpertraining auszugleichen. Schliesslich wird das Essverhalten von einer an sich genussvollen Aktivität in unserem Leben zu einem Zentrum des Leidens und der Angst. Trotzdem warten viele Betroffene lange, bis sie sich bei einer Ärztin oder einer spezialisierten Fachstelle melden, weil sie sich für ihr Verhalten häufig schämen und sich als Versager fühlen.
Auswirkungen auf den Körper bei Adipositas:
- Hoher Blutdruck
- Störungen des Zucker- und Fetthaushaltes
- Gicht
- Überlastungen des Skeletts mit Arthrosebildung
- Häufigkeit gewisse Krebsarten steigt
«Soziale Medien spielen heutzutage eine grosse Rolle, wenn es darum geht, das Verhalten von jungen Menschen, aber mittlerweile auch von älteren Menschen, zu prägen.»
Dr. med. Bettina Isenschmid, Spital Region Oberaargau AG
Welche Rolle spielen soziale Medien und der Druck zur Körperperfektion bei der Entstehung von Essstörungen?
Es wird häufig ein perfekter und leistungsfähiger Körper vorgezeigt, es werden allerlei Tipps gegeben, wie man in kurzer Zeit viel Gewicht abnehmen oder fit werden kann. Diese Vorgaben sind natürlich nicht realistisch, doch können dies Menschen, die aufgrund ihrer Figur oder ihres Essverhaltens in Verzweiflung geraten sind, oft nicht durchschauen. Sie versuchen trotzdem und mit zunehmend ungesunden Methoden diese Idealbilder zu erreichen.
Wie kann man Menschen unterstützen, die an einer Essstörung leiden, und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Das Wichtigste ist, die Beobachtungen, die man zum Essverhalten oder auch sonst zum Verhalten der vermutlich betroffenen Person gemacht hat, zu sammeln und sie dann damit respektvoll zu konfrontieren. Keine Angst, eine Essstörung kann man nicht herbeireden, die allermeisten Betroffenen sagen in der ersten Konsultation, dass es ihnen dabei geholfen hat, sich zu melden, als sie von einer Vertrauensperson darauf angesprochen wurden. Allgemein muss gesagt werden, dass die Prognose mit zunehmender Dauer der Erkrankung schlechter wird. Ansonsten soll man Menschen mit Essstörungen nicht nur unter diesem Aspekt sehen, sondern vielmehr die gesunden Anteile stärken. Unterstützung benötigen jedoch auch die Angehörigen. Eltern und auch Freunde sind oft ebenso verzweifelt wie die Betroffenen selbst, weil sie der zunehmenden Abmagerung und der damit ansteigenden Lebensgefahr hilflos zusehen müssen.
Gibt es bestimmte Risikogruppen oder Altersgruppen, die anfälliger für Essstörungen sind?
Früher sagte man, dass vor allem Kinder und Jugendliche im Risiko stehen, an eine Essstörung zu erkranken. Heute ist jedoch bekannt, dass Menschen jeden Alters eine Essstörung entwickeln können. Risikogruppen findet man auch bei Personen, bei denen der Körper im Zentrum ihres Lebens steht wie Sportler oder Menschen in repräsentativen Berufen. Ebenso sind Suchtkranke und Menschen mit Stoffwechselstörungen und Unverträglichkeiten, welche eine Diät erfordern, erhöht betroffen.
Welche Rolle spielt das Umfeld (Familie, Freunde, Schule) bei der Prävention und Behandlung von Essstörungen?
Wie bereits erwähnt, ist das Umfeld meist mitbetroffen. Die Angehörigen und Freunde versuchen zu helfen und fühlen sich doch häufig hilflos und verzweifelt. In der Prävention haben die Schulen, aber auch andere Bereiche, wo Jugendliche zusammenkommen, eine sehr wichtige Funktion. Zentral ist es, die Vielgestaltigkeit und Individualität des menschlichen Körpers aufzuzeigen und jeden Menschen als ein geschätztes wertvolles Individuum zu sehen. In verschiedenen Schulfächern können Strategien erarbeitet werden, wie man in Momenten der Verunsicherung, wie sie z. B. in der Pubertät ja normal sind, auch anders reagieren kann, als mit einer Diät oder einer Intensivierung des Körpertrainings.
Wie wichtig ist eine multidisziplinäre Herangehensweise bei der Behandlung von Essstörungen? Welche Fachkräfte sollten daran beteiligt sein?
Die multidisziplinäre Herangehensweise bei der Behandlung von Essstörung ist heute der goldene Standard oder sollte es mindestens sein. Fachkräfte aus Medizin, Psychiatrie, Körper- und Physiotherapie, Ernährungsberatung und auch anderen Disziplinen sind beteiligt. Bei Menschen mit einer krankhaften Adipositas kann schliesslich auch die bariatrische Chirurgie hilfreich sein. Diese sollte jedoch nie als erstes Mittel gewählt werden. In der Adipositas-Behandlung sind heute auch einige Medikamente bekannt, welche die Sättigung verbessern und somit zu einer Gewichtsabnahme führen. Jedoch wirken diese Medikamente nur, solange sie eingenommen oder gespritzt werden, deshalb ist eine nachhaltige Veränderung des Verhaltens trotzdem unabdingbar.
Gibt es spezifische Herausforderungen bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Essstörungen im Vergleich zu Erwachsenen?
Da sich der kindliche und jugendliche Körper noch im Wachstum und in der Reifung befindet, wirken sich schwere Essstörungen besonders gravierend aus. So kann bei einer schweren Magersucht beispielsweise das Wachstum zurückbleiben, das Skelett kann schon früh geschädigt werden, und es kann auch zum Ausbleiben der Pubertät kommen. Beim Übergewicht im Kindes- und Jugendalter kommt es schon früh zu entsprechenden Folgekrankheiten wie Diabetes, Gicht oder Arthrosen – Krankheitsbilder die man früher nur im Erwachsenenalter kannte. Auch muss in dieser Altersgruppe die Familie zwingend miteinbezogen werden.
Welche Rolle spielt die Ernährung bei der Genesung von Essstörungen und wie kann eine gesunde Beziehung zum Essen wiederhergestellt werden?
Wie bereits erwähnt, ist die Ernährungsberatung eine besonders wichtige Disziplin in der Behandlung von Essstörungen. Die Betroffenen haben jeden gesunden Bezug zur Ernährung verloren – entweder überessen sie sich ständig, spüren kein Hungergefühl und auch keine Sättigung mehr oder sie fasten ständig, unterdrücken das Hungergefühl, haben Angst vor der Nahrung und überschätzen auch die Nahrungsmenge. Deshalb ist die allmähliche einfühlsame Vermittlung eines gesunden und bedarfsdeckenden Essverhaltens zentral wichtig.
Welche Probleme treten häufig auf?
Es verlangt ein besonderes Fingerspitzengefühl, da Menschen mit Anorexie oder Bulimie ständig Angst vor der Gewichtszunahme haben, Menschen mit Übergewicht ihre Ziele oft unrealistisch hoch ansetzen und in kurzer Zeit sehr viele Kilogramm abnehmen wollen. Hier ist es wichtig, Kenntnisse über den sogenannten Jojo-Effekt zu vermitteln, welcher bei rascher Gewichtsabnahme häufig zu einer ebenso raschen und meist noch grösseren Gewichtszunahme führt.
Wie kann die Familie unterstützend sein, ohne Druck auszuüben oder zu stigmatisieren?
Da Angehörige häufig Angst haben, dass sie bei einer Essstörung nicht wirklich helfen können und das Leben der Betroffenen in Gefahr ist, wenden sie sich nicht selten hilflos ab oder versuchen übermässig Druck auszuüben. So kann es sogar vorkommen, dass Gespräche am Esstisch gewaltsam ausarten, es beim Essen nur noch zu Streitigkeiten kommt und sich schliesslich die ganze Familie in der Essstörung gefangen fühlt. Bei Jugendlichen, die noch zu Hause leben, ist es enorm wichtig, dass die Eltern sich auf eine Linie einigen und diese auch vertreten und sich bei Bedarf auch selber Hilfe holen.
Wie sieht es im Freundeskreis aus?
Im Freundeskreis oder auch im Arbeitsumfeld ist es hilfreich, wenn eine Kontaktperson sich regelmässig bei der Betroffenen erkundigt, wie es ihr geht und ob sie sich Hilfe geholt hat, ansonsten soll jedoch die betroffene Person ganz normal behandelt und in alle Abläufe und Aktivitäten eingebunden werden. Es ist ganz wichtig, dass sich die Betroffenen weiterhin integriert und akzeptiert fühlen, ansonsten kann der Wille, wieder gesund zu werden, darunter leiden oder gar verloren gehen.
© Touring Club Schweiz TCS
Behandlung von Essstörungen Magersucht betrifft nicht nur junge Frauen, sondern Menschen jedem Alter. Eine Betroffene erzählt.
Als ihr jüngstes Kind aus dem Gröbsten raus war, fragte sich C. B.*: «Was wird nun aus mir?» Die 48-Jährige – grosse braune Augen, die dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden – verglich sich mit anderen Frauen. «Frauen, die mehr Kinder, ein grosses Haus und einen Garten haben.»
Sie selbst sei mit drei Kindern und einer Wohnung ausgelastet gewesen. «Ich habe mich gefragt: ‹Wie schaffen die das?›» Minderwertigkeitsgefühle kamen auf. «Ich dachte, ich muss jetzt etwas für mich machen.» Und so stieg sie morgens, noch bevor die Kinder wach waren, auf den Hometrainer. Zuerst zwanzig Minuten, dann immer länger. «Ich habe gemerkt, dass ich gut darin war.» Hinzu kamen Gedanken über Ernährung. «Ich wollte nur noch gesunde Sachen essen.»
So beschreibt C. B. ihren Weg in eine Essstörung. Seither sind fünfzehn Jahre vergangen. Die Essstörung begleitet sie noch immer.
Esstörung bestimmt Leben
Bettina Isenschmid gehört zu den Pionierinnen in der Behandlung von Essstörungen. Sie leitet das Zentrum für Essstörungen und Adipositas im Spital Langenthal, das letzten Herbst eröffnet wurde. Ihr Team behandelt rund tausend Patientinnen und Patienten – und ist bis Ende des Jahres bereits ausgelastet.
Die verschiedenen Essstörungen seien Ausprägungen derselben Krankheit, sagt Isenschmid. Eine Art Spektrum. Dabei könne es auch vorkommen, dass Betroffene in verschiedenen Lebensphasen verschiedene Essstörungen hätten.
«Allen ist gemein, dass Betroffene nicht mehr so essen, wie es dem Körper eigentlich guttun würde.» Essen mache keine Freude mehr. Die Gedanken drehten sich nur noch um Gewicht, Ernährung und den eigenen Körper. «Betroffene vernachlässigen andere Interessen wie soziale Kontakte, Arbeit oder Hobbys.»
Mobbing und glückliche Zeit
Zurück bei C. B. Sie lebt in einem kleinen Dorf in der Region Huttwil, die jüngste Tochter wohnt noch zu Hause, die zwei älteren Kinder sind ausgezogen. Am Esstisch erzählt sie davon, wie sie als Kind ein Pummelchen gewesen sei. Die anderen Kinder hätten sie «plaget». «Das hat mich sehr belastet.»
Nach der Schule arbeitete sie im Verkauf. Mit 22 Jahren bekam sie ihr erstes Kind – eine Tochter. Im Abstand von jeweils drei Jahren folgten ein Sohn und eine zweite Tochter. «Es war die glücklichste Zeit meines Lebens.»
Anfangs habe sie noch überlegt, nebenbei zu arbeiten. «Aber ich wollte für die Kinder da sein.» Sie habe sich gar keine Gedanken über sich selbst gemacht, erst als ihre jüngste Tochter älter wurde. «Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so gebraucht werde.»
Das Training auf dem Hometrainer, die Gedanken über das Essen hätten sie abgelenkt. So sei sie reingerutscht. «Und es wurde immer schlimmer und schlimmer.»
«Ich habe nur noch überlegt, was ich sagen soll, damit ich nicht essen muss.»
Betroffene suchen Halt
Essstörungen haben mehrere Ursachen, erklärt Bettina Isenschmid. Einerseits gebe es körperliche Aspekte wie genetische Vorbelastungen. Andererseits psychologische Aspekte. «Betroffene sind oft sehr leistungsorientiert. Sie wollen es anderen recht machen und nehmen eigene Bedürfnisse weniger wahr.»
Wer an einer Essstörung leide, merke meist, dass etwas nicht stimme. Betroffene könnten die negativen Gefühle aber nicht richtig lokalisieren und versuchten, die Spannungen mit Training oder Essen loszuwerden. «Sie suchen darin Halt.»
Eine Rolle spielen auch kritische Lebensereignisse wie Gewalt oder Beziehungen, die zerbrechen. «Das kann eine nachhaltige Verunsicherung verursachen. » Die Essstörung gebe Betroffenen die Kontrolle zurück.» Dabei würden sie sich Menschen zum Vorbild nehmen, die sie als selbstsicher wahrnähmen.
Schliesslich sei der Druck gestiegen, schlank und sportlich zu sein – auch im Alter. «Man wird nicht mehr aufgrund seiner Erfahrung geschätzt, sondern wegen des Aussehens.» Social Media verstärke diese Tendenz. Betroffene würden schlanke oder durchtrainierte Menschen sehen und dies mit Erfolg und Beliebtheit verbinden. «Das, was sie selbst auch wollen.»
Ablenkung zum Rückzug
Schönheitsideale standen für C. B. nie im Fokus. «Als Kind hätte ich es mir vielleicht schon gewünscht, so zu sein wie die anderen.» Aber als Erwachsene sei es ihr nie darum gegangen, schlank zu sein. «Das Hungern war eine Ablenkung, es hat mir Halt gegeben.»
Sie habe immer mehr abgenommen. «Die Kinder stellten Fragen. ‹Mami, warum bis du so mager?›» Sie sei solchen Fragen ausgewichen, mit Floskeln wie «So bin ich halt». Das sei stressig gewesen, aber viel darüber nachgedacht habe sie nicht. «Es kam gar nicht infrage, etwas zu ändern.»
Zie Konsequenz: C. B. zog sich immer mehr zurück. «Ich wusste, wenn ich Leute treffe, muss ich essen.» Etwas Süsses zum Kaffee, ein gemeinsames Abendessen. «Ich habe nur noch überlegt, was ich sagen soll, damit ich nichts essen muss.» Gleichzeitig war das Umfeld überfordert. «Viele wussten nicht, wie sie mit der Essstörung umgehen sollen, und zogen sich zurück.»
Schliesslich reagierte ihr Mann. «Er sagte mir, dass es so nicht weitergehen könne.» Sie habe sich lange geweigert, Hilfe anzunehmen. «Doch ich spürte auch, dass meine Kräfte schwanden.» Beim Umzug von der Wohnung in ein Haus ging es ihr so schlecht, dass die Familie die Ambulanz rufen musste. «Das hat mir das Herz gebrochen. Ich hatte nicht nur Angst um mein Leben. Mir ist auch bewusst geworden, was meine Kinder durchmachen müssen.»
Insgesamt vergingen circa zwei Jahre, bis sich C. B. in Behandlung begab.
Früherkennung ist wichtig
Je früher Betroffene Hilfe suchten, desto höher seien die Heilungschancen, sagt Bettina Isenschmid. Innerhalb der ersten zwei Jahre stünden die Chancen gut. Vergehen zwei bis vier Jahre, seien die Heilungschancen noch mässig, bei vier bis fünf Jahren ungünstig.
Innerhalb der ersten zwei Jahre hole sich jedoch kaum jemand Hilfe, sagt Isenschmid. «Umso wichtiger ist Prävention.» Die Früherkennung habe zwar an Bedeutung gewonnen. Die Klassifizierung von Essstörungen werde den Nuancen, fliessenden Übergängen und neuen Ausprägungen aber nicht mehr gerecht. Das führe dazu, dass Krankenkassen die Behandlung teilweise nicht übernähmen, wenn die Essstörung gerade erst im Entstehen sei und noch nicht alle Kriterien der Krankheit erfülle.
«Meine Essstörung ist nicht weg», sagt C. B. Es gehe ihr besser. «Aber ich habe immer noch diese Zwangsgedanken.» Da sei irgendetwas in ihrem Hinterkopf, das nicht zulasse, dass sie ihre Essstörung ganz loslasse. «Ich vertraue mir nicht, dass ich ein gesundes Essverhalten entwickeln kann.» Sie habe Angst, dass sie das Mass verliere und übergewichtig werde.
Einmal im Monat lässt sich C. B. im Zentrum in Langenthal behandeln. Dazu gehört auch eine Ernährungsberatung. Vieles sei ihr schon gelungen, erzählt C.B. «Es sind kleine Schritte, aber jeder einzelne freut mich sehr.»
Der Hometrainer sei weg. «Ich mache aber noch jeden Tag einen grossen Spaziergang.» Einige Angewohnheiten werde sie aber einfach nicht los. So esse sie beispielsweise nur einmal am Tag, nämlich gleich zum Frühstück. «Dann kann ich das Essen für den Tag abhaken.»
Wissen nimmt zu
In den letzten zwanzig Jahren habe sich in Bezug auf Essstörungen vieles verändert, sagt Bettina Isenschmid. Das Wissen von Fachpersonen sei besser geworden. Als Beispiel nennt sie Zahnärztinnen und Zahnärzte. Sie sind wichtig für die Früherkennung, weil Essstörungen die Zähne angreifen.
Lange hätten Essstörungen zudem als Krankheit gegolten, die nur Frauen betreffe. Seit einiger Zeit erhalten aber vermehrt auch Männer die Diagnose. Das führe dazu, dass sich mehr männliche Fachpersonen mit Essstörungen beschäftigen würden.
Nach wie vor gebe es aber zu wenig Anlaufstellen für Menschen mit Essstörungen. Im Zentrum in Langenthal soll das Angebot deshalb weiter ausgebaut werden. Bei Kindern und Jugendlichen fehle es beispielsweise an begleitender Unterstützung für Eltern. Ebenso soll es künftig mehr Gruppentherapien geben. Schliesslich möchte Bettina Isenschmid die Vernetzung von Fachpersonen stärken.
Scham und Erfolgserlebnisse
«Lange Zeit hatte die Magersucht die Oberhand», sagt C. B. Wie in einem Tunnel habe sie nicht nach links und nicht nach rechts geschaut und alles der Essstörung untergeordnet. «Meine Tochter hat mir erzählt, dass sie früher oft in mein Schlafzimmer gekommen ist und nachschaute, ob ich noch atme. Das habe ich nie mitbekommen.»
Nun, mit etwas Abstand, sehe sie vieles anders. «Heute bin ich zum Beispiel überzeugt, dass die Ursache meiner Essstörung die Hänselei während meiner Schulzeit ist.» Sie verspüre Scham, wenn sie an bestimmte Situationen zurückdenke. Wie sie beispielsweise beim Einkaufen Freundinnen und Bekannte mehr oder weniger ignoriert habe.
Seit über zehn Jahren ist C. B. nun in Behandlung. So viele Fortschritte wie im letzten Jahr habe sie noch nie gemacht. Woran das liegt, wisse sie selbst nicht so genau. Aber sie möchte davon profitieren. Mit ihrer Mutter habe sie abgemacht, dass sie sie jeden Tag besuche. «Ich habe mir dabei auch vorgenommen, wieder auf Menschen zuzugehen.»
Ein erstes Erfolgserlebnis hatte sie bereits: Neulich traf sie eine Frau mit einem Hund auf dem Weg zu ihrer Mutter. «Und ich habe sie einfach gefragt, ob ich ihn streicheln darf.»
© BZ Berner Zeitung
Übergewicht und Untergewicht infolge Essstörungen sind weit verbreitet und ein immer grösser werdendes Problem in der Gesellschaft. Immer mehr Menschen suchen und brauchen Hilfe, um ihr Ess-Problem in den Griff zu bekommen, doch Anlaufstellen gab es in der Region zu wenige. Bettina Isenschmid hat das Zentrum für Essstörungen und Adipositas (ZESA) in Langenthal ins Leben gerufen. Der «Unter-Emmentaler» hat mit ihr über die Beweggründe und die Tücken einer Essstörung gesprochen.
Bettina Isenschmid, Sie haben das Zentrum für Essstörungen und Adipositas in Langenthal ins Leben gerufen, warum?
Das hat sowohl berufliche wie persönliche Gründe: Seit 25 Jahren führe ich eine kleine Privatpraxis in Aarwangen bei Langenthal und behandle dort vorwiegend Essstörungen. Dabei wurde immer wieder klar, dass es zu wenig ambulante Anlaufstellen und Behandlungsplätze gab. Hilfesuchende Patientinnen müssen daher mehrmonatige Wartezeiten in Kauf nehmen. Zudem wusste ich, dass es am SRO in Langenthal zwar ein Adipositaszentrum gab, der Teil Essstörungen und hier insbesondere der psychiatrisch-psychotherapeutische Bereich aber nicht ausreichend abgedeckt war. Da ich seit einigen Jahren wieder im Oberaargau, genauer in Graben, wohnhaft bin, habe ich mich dann dazu entschlossen, von meiner vorherigen Stelle am Spital Zofingen ans SRO Langenthal zu wechseln. Zum Glück konnte mich ein Teil meines Teams auf diesem Weg begleiten, sodass wir sehr rasch einsatzfähig waren.
Was sind Ihre Erfahrungen bezüglich solcher Zentren?
Ich hatte das Glück, die erste Spezialsprechstunde für Essstörungen in der Deutschschweiz, genauer am Inselspital Bern, aufbauen zu dürfen. Später kam es dann zur Fusion mit der Adipositassprechstunde und so zur Zentrumsgründung. Ein analoges Zentrum konnte ich Jahre später am Spital Zofingen ins Leben rufen und massgeblich ausbauen. Wir hatten bereits dort sehr viele Patentinnen aus dem Kanton Bern und angrenzenden Kantonsteilen. Essstörungen und Adipositas sind komplexe psychosomatische Krankheitsbilder und bedürfen daher einer integrativen und multiprofessionellen Behandlung, wie diese eben an einem Kompetenzzentrum angeboten werden kann. Nicht eine Therapeutin oder Fachrichtung alleine kümmert sich um die Betroffenen, sondern viele Fachbereiche miteinander. Dazu gehören Innere Medizin und Psychiatrie, Psychologie, Ernährungsberatung, Bewegungs- und Körpertherapie sowie auch die Chirurgie. Dazu kommen das Sekretariat und die Pflege.
Warum widmen Sie sich genau diesem Bereich?
Glücklicherweise habe ich selber nie an einer Essstörung gelitten, doch als Mädchen und junge Frau habe ich einige Jahre Klassisches Ballett gemacht und dort viele abgemagerte Tänzerinnen erlebt, die versuchten, durch striktes Fasten einen noch idealeren Körper zu erreichen. Das war meine erste Begegnung mit Essstörungen. Später, bereits als junge Mutter, habe ich in einem wissenschaftlichen Projekt die frauenspezifischen Ursachen für Sucht und Abhängigkeit untersucht, dort habe ich mich dann stärker für die Gründe von Magersucht und Bulimie interessiert. Ernährung fand ich schon immer ein extrem spannendes Gebiet und so entschloss ich mich dazu, mich als Psychiaterin und Psychosomatikerin in diesem Bereich intensiv zu engagieren.
Ist Übergewicht ein grosses Problem?
Wenn wir davon ausgehen, dass in der Schweiz jeder zweite Erwachsene und jedes fünfte Kind übergewichtig sind, dann ist das wirklich ein grosses Problem. Die Kombination aus einem Überangebot beim Essen, zu wenig körperliche Aktivität und der Tatsache, dass Essen gut schmeckt und nicht nur den Hunger stillt, sondern auch bei vielen belastenden Gefühlen wie Angst, Trauer, Ärger oder Einsamkeit hilft, hat in unserer Gesellschaft dazu geführt. Immer noch wird in unserer Gesellschaft Essen als Belohnung oder Essensentzug als Bestrafung verwendet.
Was müsste von der Gesellschaft her geändert werden? Was könnte die Regierung dagegen tun?
Ganz wichtig ist es, dass neben dem Essen oder dem Fasten auch andere Formen der Gefühlsbewältigung erworben werden können. Wenn ein Kind weint, heisst das nicht automatisch, dass es auch hungrig ist, vielleicht braucht es auch Zuwendung, Trost, ein Gespräch oder auch nur etwas Ablenkung. Die Prävention von Essstörungen und Übergewicht fängt also schon im Säuglingsalter an. Die an Kinder gerichtete Werbung für Esswaren sowie die Idealbilder in den sozialen Medien müssen hinterfragt und limitiert werden, junge Menschen müssen dazu befähigt werden, kritische Konsumenten zu sein und nicht einfach alles zu glauben. Wir dürfen Menschen nicht auf ihr äusseres Erscheinungsbild, auf Figur und Kleidergrösse reduzieren, Selbstwert, Diversität und gute Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt beruhen, sind viel wichtiger und nachhaltiger. In allen Bereichen der Gesellschaft sollte dies gelebt werden. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir einen besorgniserregenden Anstieg von psychischen Leiden gesehen und auch realisiert, dass es nicht genügend Behandlungsangebote gibt. Hier sind die Politik und das Gesundheitswesen gefordert.
Wie entwickelt sich eine Essstörung?
eder Mensch braucht Methoden, wie er sich bei belastenden Gefühlen helfen kann, gerade in der Pubertät mit den zahlreichen körperlichen und seelischen Veränderungen kommt es zu einer tiefgreifenden Verunsicherung: Wer bin ich und wohin will ich, bin ich interessant und attraktiv genug? Wie kann ich mich gegenüber anderen abgrenzen und behaupten? Wie kann ich mir Halt und Sicherheit geben in dieser stürmischen Zeit? Viele Jugendliche beginnen dann ganz stark, an sich und ihrem Körper zu zweifeln, angeheizt auch durch die Idealbilder und die omnipräsenten Vergleiche in den Medien. Mit Diät und Sport soll der Körper in Form gebracht werden, oder durch starkes Abmagern soll auf eine innere Not, die zunächst nicht in Worte gefasst werden kann, aufmerksam gemacht werden. Der Verzicht auf Nahrung löst automatisch ein stärkeres Verlangen aus, was recht bald auch zu Heisshungerattacken mit massiven Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen und nachfolgendem Erbrechen führen kann. Bereits nach wenigen Wochen kann das «Diäten» und Trainieren süchtige Ausmasse annehmen und schliesslich so in eine veritable Essstörung münden. Die verschiedenen Formen wir Magersucht, Bulimie oder «Binge Eating»-Störung (wiederkehrenden Essanfällen), die zu Übergewicht führt, können dabei auch ineinander übergehen. Übergewicht besteht ab einem BMI von 26 kg/m2, Adipositas ab 30 kg/m2.
Was für Menschen kommen zu Ihnen?
Zu uns kommen Mensch ab etwa zehn Jahren bis ins Seniorenalter. Sie melden sich selber an oder werden von Angehörigen, Haus- und Fachärzten sowie verschiedenen Anlaufstellen zugewiesen. Wir betreuen auch Patienten, die sich einem adipositaschirurgischen Eingriff unterzogen haben.
Haben diese bereits einen jahrelangen Leidensweg hinter sich?
Meist sind sie leider bereits einige Monate bis sogar Jahre oder fast ein ganzes Leben erkrankt, oft ohne viel Hoffnung, dass sich nochmals etwas ändern könnte. Durch die Arbeit in der Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit versuchen wir, die Betroffenen zu ermuntern, sich möglichst frühzeitig zu melden. Denn je früher eine Behandlung einsetzt, desto besser die Erfolgschancen. Wenn bereits viele Jahre vergangen sind und sich die Krankheit in allen Lebensbereichen festgesetzt hat und schon viele körperliche und psychische Folgeerkrankungen da sind, ist eine Heilung leider kaum mehr möglich. In dieser Gruppe kommt es auch zu den meisten Todesfällen. Trotzdem gibt es auch bei langem Verlauf noch die Möglichkeit zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Unterstützung der Angehörigen.
Wie lange dauert eine Therapie?
Unsere Therapie sind auf eine Dauer von primär zwei Jahren angelegt, da jede Verhaltensänderung viel Zeit braucht. Meist dauern die Therapien jedoch länger, da neben der Essstörung an sich auch andere Lebensbereiche wie Familie, Beziehung, Ausbildung und Arbeit thematisiert werden müssen. Und wie bereits erwähnt, es sind immer mehrere Fachbereiche und -personen beteiligt und die körperliche Gesundheit wird genau so berücksichtigt wie die psychische.
Was sind die grössten Herausforderungen?
Oft bestehen anfangs Widerstände gegen die Therapie, vor allem, wenn sie nicht wirklich auf eigenen Wunsch beginnt. Magersüchtige haben grosse Angst vor der Gewichtszunahme und wollen die Sicherheit, die ihnen das Fasten und das Untergewicht gibt, nicht einfach so preisgeben. Demgegenüber haben die Eltern natürlich grosse Angst, ihr Kind würde nie mehr gesund werden oder gar verhungern. Es braucht bei jeder Essstörung viel Geduld und Verständnis, dass jedes Verhalten für Betroffene eine sinnvolle Funktion hat, auch wenn es von aussen nicht so aussieht. Und esssüchtige Menschen müssen lernen, dass sie ihre Gefühle anders bewältigen können als mit Süssigkeiten und Snacks. Mehr Bewegung, um die Gewichtsabnahme zu unterstützen, ist für adipöse Menschen eine riesige Herausforderung, bei der sie Hilfe brauchen.
Was ist das meist gesuchte Ziel der Patienten (Gewichtsverlust/Lebensqualität/Befreiung aus der Sucht)?
Alle drei Ziele werden genannt, Übergewichtige wollen primär abnehmen, dabei wird dann oft erst klar, wozu das Essen alles dient und dass es Alternativen dazu braucht. Ein gesundes Gewicht ist bestimmt mit einer besseren Lebensqualität und Gesundheit verbunden, dies spielt bei allen Essstörungen eine grosse Rolle. Bei der Bulimie und dem «Binge Eating» ist oft das Thema Sucht schon da, die Betroffenen erleben sich als beherrscht von ihrem Essdrang und erleben aber einen ständigen Wiederholungszwang.
Mit welchen Erwartungen kommen die Patienten zu Ihnen? Soll es aus Sicht der Patienten einfach nur schnell gehen?
Natürlich kommen die Patienten mit der Erwartung zu uns, dass es ihnen schnell besser gehen soll, manchmal erschrecken sie zu Beginn, wenn wir ihnen sagen, dass es Monate oder meist Jahre braucht, doch bereits nach kurzer Zeit erkennen sie selber, dass sie Geduld haben und dranbleiben müssen, um nachhaltigen Erfolg zu haben. Ansonsten gibt es ja einfach nur wieder die x-te Diät, das x-te Fitnessabo, wieder mal auf die Zähne beissen und sich nichts mehr gönnen, das führt nie zum Ziel.
Was wünschen sich Menschen mit Essstörungen?
Sie wünschen sich vor allem, ernst genommen zu werden, auch wenn sie sich für ihr Verhalten oft schämen. Oft wirkt dieses für andere befremdlich und unverständlich und kann auch Aggressionen oder Ablehnung auslösen. In diesen Situationen benötigen sie ein respektvolles und einfühlsames Gespräch sowie viel Geduld – auch mit sich selbst –, um die erforderlichen Verhaltensänderung aufbauen, in ihr Alltagsleben zu integrieren und langfristig durchhalten zu können. Auch Angehörige brauchen viel Unterstützung, da sie sich ob der Erkrankung der Betroffenen häufig hilflos und ohnmächtig fühlen.
Wer kann zu Ihnen kommen?
Zu uns können alle Menschen kommen, die ein Problem mit dem Essen und/oder dem Gewicht haben. Falls sie in einem Hausarztmodell oder Managed Care Modell versichert sind, benötigen wir eine ärztliche Zuweisung. Aber auch sonst ist uns die Zusammenarbeit mit den Haus- und Kinderärzten sowie anderen beteiligten Fachstellen ein ganz grosses Anliegen. Wir bieten nur ambulante Behandlungen an, sollte eine Klinikeinweisung nötig sein, arbeiten wir vor allem mit der Klinik Wysshölzli in Herzogenbuchsee und mit anderen psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken in unserem Einzugsgebiet zusammen.
Kann man auch ein erstes beratendes Gespräch bei Ihnen führen, ohne in ein Programm einzusteigen?
Sicher, wir bieten zunächst ein Erstgespräch an. Dabei wird mit dem Patienten zusammen besprochen, wo sein Leidensdruck ist und was er braucht. Erst danach planen wir die weiteren Behandlungstermine. Die Behandlungen sind Pflichtleistungen und werden von Krankenkassen abzüglich des Selbstbehalts und der Franchise übernommen. Unser Team umfasst derzeit 12 bis 14 Personen aus den verschiedenen anfangs erwähnten Fachbereichen.
Was sagen Sie zur Formel: Körpergrösse minus 100 = ideales oder gutes Gewicht?
Von dieser Formel sind wir schon länger abgekommen, auch der Begriff des Idealgewichts ist nicht mehr zeitgemäss. Die Gewichtsklasse, wenn man so will, wird mit dem BMI (Body-Mass-Index) bestimmt, welcher sich so berechnet: Körpergewicht in Kilogramm/Körpergrösse in Metern im Quadrat (kg/m2). Für Menschen, die sich noch im Wachstum befinden, gibt es altersangepasste Werte, sogenannte Perzentilenkurven. Heute sprechen wir von Gewichtsbereichen und sind uns bewusst, dass nicht nur das Gewicht über Gesundheit oder Krankheit bestimmt. Wichtig sind auch der Körperbau und die Körperzusammensetzung, bei der Adipositas messen wir daher auch den Bauch- und Hüftumfang. Adipositas besteht wie oben erwähnt ab BMI 30 kg/m2, Übergewicht ab 26 kg/m2, Normalgewicht zwischen 18 und 25 kg/m2, Untergewicht unter 18 kg/m2.
Wie sehen Sie die Zukunft bezüglich Essstörungen? Nehmen Sie zu? Sind die Zahlen bedenklich?
Die Häufigkeit der Magersucht hat sich, soweit wir wissen, nicht bedeutend verändert, jedoch treten die Bulimie und die «Binge Eating»-Störung häufiger auf. Es sind auch vermehrt Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen von verschiedenen Essstörungen betroffen. Da die Übergewichtigkeit in der Bevölkerung stark verbreitet ist, sehen wir auch immer mehr damit verbundene Probleme des Essverhaltens.
Haben Sie bereits viele Patienten in ZESA? Ist der «Ansturm» gross?
Ja, gegenwärtig sind wir bis Ende des Jahres eigentlich ausgebucht, für dringende Fälle versuchen wir aber trotzdem, eine rasche Abklärung zu ermöglichen. Oft kann schon ein einzelnes Gespräch, in dem sich die Betroffenen aber akzeptiert fühlen, wieder Zuversicht bewirken.
Haben Sie genug Kapazität für die nächsten Jahre?
Wir müssen mit der Nachfrage sicher Schritt halten, indem wir genügend Fachpersonen aus Medizin und Psychologie zur Verfügung haben, da müssen wir immer vorausschauend planen. Zurzeit sind wir gut aufgestellt, aber auch wir spüren den Fachkräftemangel.
© Unter-Emmentaler
Die reformierte Pfarrerin Claudia Graf arbeitet als Seelsorgerin am Spital Langenthal. Gleich um die Ecke fliesst die Langete vom Städtchen her in die lieblichen Wässermatten hinaus. Auf Spaziergängen durch diese Landschaft wird ihr Geist ruhiger und ihre Seele wird offener.
«Ich schätze es, die Oberaargauer Wässermatten praktisch vor der Spitaltür zu haben. Für ein längeres Telefonat oder nach einem schwierigen Gespräch kann ich hier hinauskommen. Und manchmal schlage ich Patient:innen, die gut zu Fuss sind, fürs Seelsorgegespräch einen Spaziergang an der Langete vor.
Allein unterwegs nehme ich die Natur mit allen Sinnen wahr: die unterschiedlichen Bäume und Vogelrufe, den Ausblick, der sich auf die Jurakette hin weitet, den Duft der verschiedenen Felder. Darüber hinaus bin ich draussen auch gern aktiv. So habe ich diesen Frühling in meiner zweiten Heimat im Berner Oberland ein kleines Kartoffelfeld angelegt – dort treffen ‹ora et labora›, mein Seele-baumeln-Lassen und das Erdverbunden-Sein aufeinander.
Ab und zu steige ich gern für ein erfrischendes Fussbad in die Langete. Ich hab's eher mit der Kälte als mit der Hitze. Im Winter 2021/22 konnte ich während eines Forschungsurlaubs im Lütschisand am Brienzersee wöchentlich Eisbaden – ein existenzielles Erlebnis! Danach fühle ich mich immer hellwach, glücklich und wie neugeboren.
Seelsorge ist die Muttersprache der Kirche. Als Spitalseelsorgerin bin ich am Rand der Kirche und des Gesundheitswesens tätig. Eine gute Beziehung zu den Mitarbeitenden – von den Pflegenden und Ärzt:innen über den Technischen Dienst bis hin zur Verwaltung und der Küche – ist das A und O. Wenn mir die Belegschaft vertraut, weist sie mich auch auf wichtige Situationen hin. So komme ich eher dorthin, wo ich gebraucht werde.
Das Rauschen der Blätter und das Plätschern des Flüsschens beruhigen mich. Im Wald und am Wasser fühle ich mich geborgen. Weiter oben fliesst die Langete am Wuhrplatz vorbei, wo auch das Chrämerhuus steht (siehe Kasten). Über dem Bachbett hängt ein Schild mit der Aufschrift ‹Zum Meer›. Diese Verbindung mit dem Grossen gefällt mir.»
© Pfarrblatt Nr.16
Daniela Bodmer ist nach einer eigenen Diät-Odyssee Ernährungsberaterin und rät ihrer Kundschaft zu essen, worauf sie Lust hat. Kann das aufgehen? Das sagt die Medizin.
Fleischdiät, Fasten, Fruchtdiät, Akupunktur, Heilpraktiker – Daniela Bodmer hat in ihrem Leben schon «jeden Scherz mitgemacht», um abzunehmen. Heute, als schlanke 50-Jährige, kann sie das mit einem Schmunzeln sagen. Als junge Frau nahm das Thema Essen jedoch all ihre Aufmerksamkeit ein. Zwanghaft. Ihre Diät-Odyssee startet im Alter von 13 Jahren. Schnell zeigt die Waage mal fünf, zehn und auch mal fünfzehn Kilogramm mehr und wieder weniger an. Der typische Jojo-Effekt. Als sie über längere Zeit Abführmittel zu sich nimmt und dazwischen wiederholt Fressattacken erlebt, kommt Bodmer mit einer Essstörung in eine Klinik. Nach vier Monaten entlassen sie die Ärztinnen und Ärzte wieder. In ihre Akte schreiben sie: nicht therapierbar.
Diese Worte hallen in Bodmer nach. «Plötzlich hatte ich die Nase gestrichen voll!» Während andere Menschen Grosses schafften, zählte sie Kalorien. Eine ermüdende, nie endende Beschäftigung. «Und so eine Energieverschwendung!», sagt Bodmer heute. Mit 21 Jahren kapituliert sie schliesslich. Sie will nicht mehr abnehmen. Ihr ist egal, wenn sie zunimmt, wenn sie irgendwann das jahrelang gefürchtete Adjektiv «dick» verkörpert. Sie will einfach nur noch normal essen können.
Gibt es Intuition beim Essen?
Der Zufall will es, dass ihr eine Freundin das Buch «Overcoming Overeating» aus den USA mit nach Hause bringt. Geschrieben haben es 1988 die beiden Psychotherapeutinnen Jane Hirschmann und Carol Munter. Das Buch öffnet ihr die Augen. Darin steht nämlich: Der Mensch kann sich eigentlich intuitiv ausgewogen und gesund ernähren. Aber stimmt das wirklich? Eine Antwort weiss Bettina Isenschmid. Sie ist Psychosomatikerin und Chefärztin am Zentrum für Essstörungen und Adipositas (ZESA) bei der Spital Region Oberaargau. Sie sagt: «Ja, Intuition bei der Ernährung gibt es.» Sogenannte «Buffet-Studien» mit Kindern hätten gezeigt, dass diese sich über einen Monat lang ausgewogen ernährten, wenn sie jeden Tag von einem breiten Angebot von Gemüse, Früchten, Kohlenhydraten, Fleisch und sogar Süssigkeiten wählen können. Sie folgten ihrem natürlichen Hunger-, Lust- und Sättigungsgefühl. Hörten auf «innere Signale», wie Isenschmid sie nennt. Diese senden Hirn und Magendarmtrakt aus. Je älter wir werden, desto mehr übernehmen jedoch «äussere Signale». Darunter versteht Isenschmid etwa gängige Schönheitsideale, denen man täglich in den Medien begegnet, aber auch Werbung, die verspricht: Mit diesem Fertigprodukt erreichst du ein besseres, glücklicheres, vielleicht auch schlankeres Leben. Andererseits beeinflusst uns auch unser soziales Umfeld. Essen Mutter oder Vater nicht gerne Gemüse und Früchte, übernimmt man diese Abneigung. Das macht intuitiv ausgewogene Ernährung bereits schwer. Ist ein Elternteil auch noch ständig auf Diät oder kommentiert jemand im Umfeld das eigene Aussehen, entstehen jung die Gedanken: Ich bin dick und muss abnehmen. Also beginnt man die erste Diät. «Diese ist für viele der erste Schritt auf dem Weg in eine Essstörung oder zum Übergewicht», sagt Isenschmid. Auch Daniela Bodmer entkam dem Diät-Teufelskreis erst, als sie mit 21 Jahren in den Flieger in die USA stieg. Dort nahm sie an einem Anti-Diät-Programm der Autorinnen Hirschmann und Munter teil. Wenig später machte sie bei selbigen eine zweijährige Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Als solche berät sie heute in der Stadt Basel Frauen und Männer zu einer «bedürfnisorientierten Ernährung». Oder wie sie heute von Tiktok-Ernährungscoaches genannt wird, die sich beim Essen filmen und Tipps geben: intuitive Ernährung. Die Grundregeln der intuitiven Ernährung klingen erst einmal einfach. Es gibt keine Verbote. Kein gutes und schlechtes Essen. Man darf alles und so viel zu sich nehmen, wie man braucht. Aber isst man dann nicht jeden Tag von früh bis spät massenhaft Schoggi, Pommes und Burger? Klar, das könne in einer ersten Trotzphase passieren, sagt Bodmer. Aber spätestens nach zwei Wochen könnten die meisten kein Fett und Zucker mehr sehen. «Und sie merken auch: Das tut mir überhaupt nicht gut.»
Modelmasse sind nicht greifbar
Bei intuitiver Ernährung geht es laut Bodmer deshalb auch darum, herauszufinden, welches Essen einem die Energie und die Befriedigung gibt, die man gerade braucht. Das merke man. Der Körper sende Signale. Etwa, wenn man plötzlich richtig Lust auf Spaghetti hat. «Dann solle man auch eine Portion Spaghetti essen.» Der Körper verlange Kohlenhydrate. Das nächste Mal hat man dann Lust auf Salat, ein Guetzli oder Fleisch. «Wichtig ist dann nur noch, genau dann mit dem Essen aufzuhören, wenn man satt ist. Nicht früher und nicht später», sagt Bodmer. Das sei zu Beginn schwierig. Viele hätten verlernt, das Gefühl der Sättigung wahrzunehmen. Klappt es allerdings, so halbierten viele ihre Portionen. «Abnehmversprechen » macht Bodmer auf ihrer Website dennoch nicht. Und das bewusst. Sie sagt klar: Modelmasse erreicht man mit intuitiver Ernährung nicht. Gewichtsverlust trete eher als Nebenerscheinung auf. Dabei verlieren die Leute höchstens das Gewicht, das sie davor wegen ständigem Überessen zu viel wogen. Bodmer wiederholt: «Intuitive Ernährung ist keine Diät. Es ist eine Anti-Diät.» Auch im ZESA verfolgen Bettina Isenschmids Patientinnen und Patienten in erster Linie das Ziel, wieder in Kontakt mit ihren inneren Signalen zu kommen. Hunger, Sättigung, Lust. «Also eigentlich zentrale Anliegen der intuitiven Ernährung», sagt Isenschmid. Das Abnehmen könne wie nebenbei geschehen. Wichtiger sei das Erlernen eines gesunden, wohlwollenden Umgangs mit Essen und dem eigenen Körper.
Glücklicher durch richtiges Essen
Da wäre es also, das Rezept für ein gesundes Körpergewicht. Doch sowohl Ernährungsberaterin als auch Ärztin sagen: Intuitive Ernährung ist nicht für alle umsetzbar. Bodmer erzählt von Kundinnen, die einfach nicht aus dem Abnehm-Denken herauskommen und aus intuitiver Ernährung eine neue Diät machen. Und Isenschmid sieht bei ihren Patientinnen und Patienten nur in rund einem Drittel Erfolg. Zwei Drittel schafften es nicht, dem Einfluss der äusseren Signale zu entkommen. «Man muss intuitive Ernährung jedoch nicht vollends umsetzen können, um sich befreiter, glücklicher und zufriedener zu fühlen», sagt Isenschmid. Diese Aussage unterstützt auch eine Metastudie von 2021, welche 97 Studien untersuchte. Diese kam zum Schluss, dass intuitive Ernährung mit einem positiven Körperbild, einem positiven Selbstwertgefühl und demWohlbefinden korreliert. Ein Hoffnungsschimmer für all jene, die es nie vollends schaffen werden, ihre Diät-Odyssee zu beenden.
... dann ist die mobile Akutbehandlung (moab) der psychiatrischen Dienste SRO Langenthal da. Sie betreut Patientinnen und Patienten, welche sich in einer akuten psychischen Krise befinden, in ihrem gewohnten Umfeld - also zu Hause. Der «Unter- Emmentaler» begleitete den Psychologen Adrian Widmer und die Pflegefachfrau Maja Domislic bei einem Besuch einer Patientin.
Marianne Ruch
Strahlend öffnet Manuela H. (*) ihre Wohnungstüre. Man sieht der jungen Frau nicht an, dass sie in einer Krise steckt. Sie hat sich auf den Besuch gefreut und ist gerne bereit, Auskunft zu geben. Bewundernswert, denn psychisch krank zu sein wird oft als peinlich abgestempelt und man schämt sich.
«Man soll sich nicht schämen, denn bei der Seele ist der Psychologe einfach der Physiotherapeut für die Seele.» - Manuela H.
«Man soll sich nicht schämen», sagt sie. «Es ist, wie wenn man einen Beinbruch hatte, da nimmt man den Physiotherapeuten in Anspruch. Bei der Seele ist der Psychologe dann einfach der Physiotherapeut für die Seele», sagt sie bestimmt.
Die grosse Leere
Manuela H. ist 40 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und ein schönes Haus. Eigentlich alles, um glücklich zu sein, oder? «Ich habe mich für andere verausgabt bis ich total erschöpft war. Ich hatte nur noch negative Gedanken, war traurig und hatte keine Kraft mehr. Ich hatte eine grosse Leere in mir und war selbst böse mit mir. Ich redete mir ein, dass ich nichts auf die Reihe kriege, nichts schaffe und nichts bin. Ich dachte, es ist ja kein Wunder, dass mich niemand mag und niemand etwas mit mir zu tun suchte Anerkennung durch Helfen und verausgabte mich dadurch komplett.
«Ich wollte nicht in die Klinik. Denn ich wollte meine Familie nicht im Stich lassen.» - Manuela H.
Und vor allen Dingen vergass ich mich dabei selbst.» Dann hat sie sich selbst Hilfe geholt. Nicht zum ersten Mal. «Ich habe seit 20 Jahren immer wieder Krisen, war auch schon stationär in einer Klinik. Aber diesmal konnte und wollte ich nicht in die Klinik. Ich konnte und wollte meine Familie nicht im Stich lassen. Zu organisieren wäre es sicher gewesen, aber das schlechte Gewissen und die ständigen Gedanken, ob zu Hause alles funktioniert, hätten mich mehr belastet, als mir der Aufenthalt genutzt hätte», erzählt sie ihre Wahl für das «moab». «Oft ist es so, dass dann das schlechte Gewissen <therapiert> werden muss und das eigentliche Problem in den Hintergrund rutscht», bestätigt Psychologe Adrian Widmer.
Therapie zu Hause
«Ich war damals einfach froh, dass sie da sind und mir helfen», meint Manuela H. auf die Frage, ob es nicht komisch war, als die Betreuung zum ersten Mal zu ihr nach Hause kam. «Das sind professionelle Menschen, die mich fragen, wie es mir geht und mir helfen wollen. Es sind keine Schnüffelnasen und sie urteilen nicht über mich, wenn vielleicht nicht Staub gesaugt oder nicht abgewaschen ist.» Es sei, wie wenn sie Besuch bekommen würde. «Und mit der Betreuung bei mir zu Hause bin ich näher am normalen Leben. Wenn ich sechs Wochen in die Klinik gehen würde, käme ich zurück und müsste erst wieder im Alltag ankommen». Am Anfang besuchte die Bezugspflegende Maja Domislic Manuela H. jeden Tag. Adrian Widmer war ein- bis zweimal die Woche bei ihr vor Ort und führte Gespräche mit ihr. Mit der Zeit konnten die Gespräche zwischendurch auch per Telefon geführt werden, was für die Patientin auch sehr gut war. Maja Domislic: «Wir Pflegefachpersonen helfen den Patientinnen und Patienten, damit sie ihren Alltag wieder gestalten können und helfen so, die Ressourcen der Patienten wieder zu finden. Wenn es nötig ist, geben wir Starthilfe, etwa um einkaufen zu gehen oder was sonst alles anfällt, das der Patientin Mühe bereitet». «Für uns ist der Besuch und die Betreuung zu Hause sehr wertvoll und gibt uns einen Einblick in das Umfeld des Patienten», erklärt Adrian Widmer. «Ich fühle mich mit <moab> sehr gut aufgehoben und betreut. Zu Hause kann ich mehr mich selbst sein, als wenn ich in die Praxis gehen müsste», sagt Manuela H.
Die «moab» ist sehr stark mit der Spitex, Hausärzten, Erziehungsberatung und vielen weiteren Institutionen vernetzt und kann im Bedarfsfall weitere Unterstützung hinzuholen.
Sie ist sieben Tage die Woche an 24 Stunden erreichbar. Manuela H. hätte sich auch getraut, mitten in der Nacht um Hilfe zu bitten. «Die Betreuenden sind ausgebildet dafür und wissen, dass jederzeit jemand anrufen kann», sagt sie. «Wenn es nötig ist, fahren wir mitten in der Nacht zu den Patienten», sagt Maja Domislic ganz selbstverständlich. Es sei wichtig, Hilfe zu bekommen, wenn man sich denn schon traue, anzurufen.
Auf dem Weg zur Besserung
Wie ist es für die Familie von Manuela H.? «Mein Mann ist froh, dass ich Hilfe bekomme und er spürt auch, dass es mir langsam besser geht. Er lässt uns Raum zum Reden und ist bei Bedarf auch bei den Gesprächen mit dabei», erzählt sie offen. «Die Kinder verstehen mit ihren fünf und sieben Jahren noch nicht so richtig, worum es geht. Sie wissen einfach, die Mama bekommt Besuch und dieser fragt, wie es mir geht.» Adrian Widmer findet, Manuela H. habe eine sehr gute Art, mit ihren Kindern zu kommunizieren. «Ich habe meinen Kindern mit Hilfe von einem Buch erklärt, dass ich eine dunkle Wolke vor mir habe, die mich traurig macht. Dass sie aber nicht schuld sind an dieser Wolke und dass ich die Wolke mit dem Besuch wieder kleiner mache, damit die Sonne wieder durchscheinen und ich mich wieder freuen kann.» Und so bekommen die Kinder nicht viel mit, nehmen es an, wie es ist. Manuela H. ist auf dem Weg der Besserung, sie hat gelernt, besser auf sich acht zu geben und sich Zeit für sich zu nehmen. Und das Wichtigste: Sich abzugrenzen. «Es ist nicht immer einfach, aber ich habe eine sehr gute Betreuung, die mich unterstützt und jederzeit für mich da ist», sagt sie. Medikamente und weitere ambulante Gespräche helfen ihr, in Zukunft stabil zu bleiben. Denn die Heim-Betreuung endet bald. «Irgendwie bin ich froh, es gibt mir wieder mehr Freiraum. Aber dennoch ist es ein Abschied, der schmerzt, da mir das Behandlungsteam auch ans Herz gewachsen ist», sagt sie mit tränenerstickter Stimme. Sie sagt selbst, dass ihre Probleme sie ihr Leben lang begleiten werden. «Aber ich habe gelernt, dass ich Hilfe annehmen darf und diese Krisen nicht alleine durchstehen muss. Ich bin stolz auf mich, dass ich selbst Hilfe geholt habe», sagt sie. Einen Wunsch hat sie: «Ich möchte einmal so intensiv glücklich sein, wie ich traurig bin.» Eine Aussage, die berührt und nachdenklich stimmt.
«Die <moab> schliesst eine Lücke zwischen der ambulanten und der stationären Betreuung.» - Adrian Widmer
Home-Treatment - «moab»
«Home-Treatment», die mobile Akutbehandlung (moab), startete im März 2020 und war ein Versuchsprojekt. Mittlerweile ist aus dem Projekt ein fester Bestandteil der psychiatrischen Dienste des SRO geworden und nicht mehr wegzudenken. Die Behandlungsform sei sehr nachhaltig. «Die <moab> schliesst eine bestehende Lücke zwischen der ambulanten und der stationären Betreuung», sagt Adrian Widmer überzeugt. Die Rückmeldungen seien durchwegs positiv und die «moab» sei nicht mehr wegzudenken. Manuela H. ergänzt: «Man kann mit der <moab> die Anonymität besser wahren. Man kann zu Hause bleiben und ist nicht sechs Wochen einfach weg. Vielleicht trauen sich durch dieses Angebot mehr Menschen, Hilfe in Anspruch zu nehmen - ich wünsche es mir, denn es würde sicher vielen Menschen gut tun, etwas mehr auf sich acht zu geben», sagt sie hoffnungsvoll. Maja Domislic ergänzt: «Es ist sehr wichtig, dass die Menschen wissen, dass sie Hilfe einfordern dürfen und auch erhalten. Sie müssen nicht mit einer ärztlichen Diagnose <psychisch krank> einhergehen. Wenn jemand merkt, es wird mir zu viel, dann darf und soll sich die Person melden. Dafür sind wir da.» Maja Domislic und Adrian Widmer gehen mit sehr viel Feingefühl, grossem Respekt und Konzentration auf ihre Patienten ein - nicht umsonst musste sich Manuela H. Tränen wegwischen.
© Unter Emmentaler
Marianne Ruch im Gespräch mit Dr. med. Manuel Moser, Chefarzt Psychiatrische Dienste im SRO, und Tschowe Wildbolz, Bereichsleiter Home-Treatment.
Manuel Moser, wie kamen Sie auf die Idee, Heim-Betreuung anzubieten?
Manuel Moser: Wir haben vor Jahren festgestellt, dass wir weniger als die Hälfte aller Oberaargauer, die eine psychiatrische Hospitalisation benötigen, auch bei uns am SRO und somit in der Region versorgen können. Das Psychiatriezentrum Münsingen als unser traditioneller Partner ist halt schon recht weit weg. Dazu hatten wir viele Rückmeldungen von Betroffenen und Hausärzten, mehr Kapazität zu schaffen. Also dachten wir zuerst daran, einfach eine zusätzliche Bettenstation zu bauen. Wir hatten ja schon zwei, die sehr gut funktionierten. Dann stiessen wir auf neue Modellprojekte vom sogenannten «Home-Treatment». Die Idee, dass sich nicht die Menschen auf uns zu bewegen müssen, sondern wir uns auf sie und ihr Umfeld, hat bei uns rasch gezündet. Wir dachten, dass der Widerstand für eine notwendige psychiatrische Behandlung vielleicht kleiner wäre und wir früher eingreifen könnten. Wir wollten also eine Art virtuelle Station aufbauen. Als dann noch der Kanton Pilotprojekte dazu ausschrieb, passte uns das genau. Die Spitalführung machte auch mit. Wir packten die Chance! Die Psychiatrie soll sich am •Menschen orientieren und nicht umgekehrt.
Was genau ist das Home-Treatment?
Tschowe Wildbolz: Wir bieten eine Art «Station auf Rädern» an. Wir haben sechs Autos, die übrigens nicht mit SRO angeschrieben sind. Wir liefern auf Fachchinesisch «akutstations- äquivalente Behandlung» täglich nach Hause. Unser Team ist, ähnlich wie auf der Station, interdisziplinär aufgestellt mit Berufsleuten aus den Bereichen Psychiatrie-Pflege, Psychologie, Medizin und Sozialarbeit. Besuche finden ein- bis mehrmals täglich statt, der Zeitraum der Behandlung beinhaltet Tage bis Wochen, mit dem Fokus auf der akuten Situation. Die Betroffenen können 24 Stunden an sieben Tagen die Woche auf den Pikettdienst zugreifen, der stützende Entlastungsgespräche bietet und bei Bedarf auch in der Nacht ausrückt. Im Vergleich zum stationären Aufenthalt ist automatisch die Beratung und Unterstützung der Angehörigen etwas niederschwelliger möglich.
Wann sind Sie mit dem Projekt gestartet? Und in welchem Umkreis bieten Sie die Heim-Betreuung an?
Tschowe Wildbolz: Wir gingen am 16. März 2020, zu Beginn des Covid-19 Lockdowns, zu unserer ersten Patientin. Wir bieten unsere Dienste im ganzen Oberaargau an, von Eriswil bis Farnern.
Werden Sie beim Projekt von Institutionen unterstützt?
Manuel Moser: Wir arbeiten mit dem Netzwerk zusammen, das wir schon gut kennen. Also mit hiesigen Psychiatern, Hausärzten und den Spitex- Diensten. Unterstützung bekamen wir vom Kanton durch eine sogenannte Anschubfinanzierung. Ohne die hätten wir nicht starten können.
Stellt das «Home-Treatment» ein eigenes Team?
Manuel Moser: Ja, vergleichbar mit dem Team, das auf der Akutstation arbeitet. Die Teamleitung ist auch Mitglied der obersten Leitung des Psychiatrischen Dienstes.
Wurde das Team speziell dafür zusammengestellt?
Tschowe Wildbolz: Ja, wir hatten einige wenige interne Bewerbungen und meistens externe, die wir ab Sommer 2019 rekrutierten.
Wie viele Mitarbeitende umfasst das Team?
Tschowe Wildbolz: Eine ärztliche und pflegerische Leitung, dann sieben Pflegefachleute, drei Psychologinnen und Psychologen oder Ärztinnen und Ärzte, eine Sozialarbeiterin und eine Sekretärin. Insgesamt 12,3 Stellen.
Bedarf diese Betreuungsform einer speziellen Ausbildung?
Manuel Moser: Die gibt es so eigentlich nicht, sondern sie entspricht einfach einer üblichen fachpsychiatrischen Ausbildung. Aber wir suchten natürlich Berufsleute mit Erfahrung, die viel Selbstverantwortung übernehmen wollten, weil sie den Menschen in seiner Krise - anders als auf der Station - nicht nonstop im Auge haben können. Zudem musste man auch noch die Freude an einem Pionierprojekt mitbringen.
Sind die Betreuenden stets alleine unterwegs?
Tschowe Wildbolz: Wir arbeiten mit dem dualen Fallführungsprinzip, das heisst, dass sich je eine Pflegeperson und eine Therapeutin aus dem Bereich Medizin oder Psychologie die Fallführung teilen, also die primären Bezugspersonen sind. Deshalb gehen wir zu Beginn oft zu zweit auf Hausbesuch, dann kann man sich direkt vor Ort absprechen und den Behandlungsplan gemeinsam erstellen. Wenn sich die Situation etwas stabilisiert hat und das gegenseitige Vertrauen da ist, machen wir Termine im Einzelsetting.
Für wen ist diese Betreuungsform geeignet?
Manuel Moser: Sie ist für Menschen, die sich in einer akuten, psychischen Krise und Krankheit befinden und früher auf eine psychiatrische Bettenstation zugewiesen worden wären, dies aber nicht wollten. Das sind etwa Eltern mit kleinen Kindern oder Menschen mit Haustieren. Oder auch Menschen, die zumindest Teilzeit arbeiten können und wollen, weil es ihnen in der Krise hilft.
Trifft das Angebot der Heim-Betreuung bei Patienten auf offene Ohren?
Manuel Moser: Oh ja. Wir bekommen direkte und positive Feedbacks. Zudem mussten wir in den ersten zwei Jahren dem Kanton Daten liefern, die uns durch ein wissenschaftliches Team aufbereitet wurden. Die Patienten und die Angehörigen bekamen anonymisierte Fragebogen zur Behandlungszufriedenheit. Die Rückmeldungen waren enorm gut und hat uns positiv überrascht. Fähigkeiten, die nach wie vor funktionieren, werden gefördert und können gleich zu Hause geübt werden.
Wir hatten auch Patienten, die schon auf Bettenstationen waren, dort gesünder wurden, aber zu Hause allzu rasch wieder in alte Muster und Krisen fielen. Diese wollten unser neues Angebot ausprobieren und profitierten natürlich davon, dass man zu Hause sozusagen in der Lebensrealität alle Schwierigkeiten live sah und sie so zielgerichteter unterstützen konnte.
«Die Rückmeldungen waren enorm gut und haben uns positiv überrascht.» - Dr. med. Manuel Moser
Wie sind die Rückmeldungen der betroffenen Personen?
Tschowe Wildbolz: Genau so positiv wie für unsere Station, das hatten die Forscher untersucht. Auch machten die Patienten mit dieser Behandlungsform gleich viele oder gar noch mehr Fortschritte
Und was für Rückmeldungen erhalten Sie von Angehörigen?
Tschowe Wildbolz: Ja, da hatten wir die grössten Befürchtungen, weil sie ja oft auch in die Behandlung mit einbezogen wurden. Wir schauten aber auch, dass sie sich abgrenzen und erholen konnten. Die Rückmeldungen waren grundsätzlich sehr positiv, da haben wir schon gestaunt. Es gab vereinzelt Angehörige, die die Mitverantwortung gerne für ein paar Tage an eine Station ausgelagert hätten. Dazu passte dann unser sogenanntes «Backup-Bett» auf unserer Station im SRO sehr gut; wir blieben für dieses «Timeout» von zu Hause für maximal drei Tage weiterhin zuständig und machten dann sozusagen den Hausbesuch auf der Station.
Wie viele Patienten hatten Sie bis an- hin in dieser Betreuungsform?
Tschowe Wildbolz: 287, Stand heute.
Wie geht es weiter - jetzt kommt die Auswertung zum Projekt, und dann?
Manuel Moser: Wir wollen das Angebot und diese Betreuungsform unbedingt weiterziehen. Das Projekt hat sich zu einem wichtigen Glied in der Versorgungskette gemausert. Es schliesst eine Lücke. Mit den positiven Auswertungen gehen wir dann zu den Krankenkassen, damit wir das Angebot auch weiter betreiben können.
Wie beurteilen Sie selber das Projekt?
Tschowe Wildbolz: Es ist ein voller Erfolg und macht viel Freude. Wir sind näher an der Realität und Normalität des Patienten. Die Psychiatrie muss sich den Bedürfnissen der Patienten anpassen und nicht umgekehrt.
«Wir sind mit dem Home-Treatment näher an der Realität und Normalität des Patienten.» - Dr. med. Tschowe Wildbolz
Was sind die Vorteile, was die Nachteile?
Manuel Moser: Vorteile sind sicher, dass es gelang, Menschen zu behandeln, die sonst auf die Station gekommen wären. Die Behandlung zu Hause ist näher am echten Leben und dadurch wahrscheinlich auch nachhaltiger, wie die Forschung im Home- Treatment der Kinder- und Jugendpsychiater in Bern zeigte.
Ein Nachteil ist sicher die Finanzierung: Da haben wir das grosse Problem, dass der Tarif, den wir abrechnen können, überhaupt nicht auf unsere intensive Behandlungsform ausgerichtet ist. Wir können nur den Tarmed-Tarif, der für private Praxen erfundenwurde, ab rechnen. So kann die Rechnung letztlich nicht aufgehen. Deshalb versuchen wir, mit den Krankenkassen eine spezielle Abrechnungsform, ähnlich den stationären Tagestarifen, auszuhandeln. Erste Kontakte hatten wir schon, aber wir vermissen etwas die Begeisterung für dieses Angebot, welches ja auch etwas günstiger als die stationäre Behandlung kommt.
Wird es in Zukunft keine Stationen mehr, sondern nur noch Behandlungen zu Hause geben?
Tschowe Wildbolz: Das glauben wir nicht. Es wird immer Menschen geben, die so stark krank und gefährdet sind, dass sie den Schutz und die Rundum-Versorgung einer Station benötigen.
Dass man wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung ist, ist in der Gesellschaft immer noch mit negativen Vorurteilen behaftet. Was sagen Sie dazu?
Manuel Moser: Dazu möchte ich das Beispiel «Depression» nennen: Sie kann jeden Menschen betreffen und erwischt jeden Fünften in der Schweiz mindestens einmal so stark in seinem Leben, dass er länger nicht mehr arbeiten kann. Es ist eine Volkskrankheit, unterdessen häufiger als Herzkrankheiten.
Es gibt auch Schweizer Persönlichkeiten, die öffentlich dazu stehen, wie etwa die Komikerin Ursula Schäppi und Radiomoderator Ruedi Josuran. Oder Winston Churchill, der immerhin eine Nation durch den Weltkrieg geführt hat. Oder Influencer, die sich outen, helfen sehr. Ein Patient hat mal gesagt, dass es eben nicht schwach sei, Hilfe zu suchen, sondern stark, zu seinen Schwächen zu stehen.
Auch in der Arbeitswelt gilt nach unserer Erfahrung: Ein (mit Mass) informierter Chef unterstützt in der Regel besser, weil er besser verstehen kann, wieso jemand plötzlich nicht mehr so arbeiten kann wie vorher. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Job behalten werden kann, ist so deutlich höher. Zeitungsberichte1 wie derjenige des «Unter-Emmentaler» dienen ebenfalls dazu, das Stigma, das in der Gesellschaft vorherrscht, zu reduzieren. Das «Normalisieren» und Sichtbarmachen von psychischen Krankheiten ist eminent wichtig.
Das Ziel ist es, dass etwa über Erschöpfungsdepression und Psychose mit gleich wenig Berührungsängsten gesprochen werden kann wie über Diabetes oder Herzinfarkt.
© Unter Emmentaler
Neue Wege für das «alte» Angebot
Leroy Ryser
Die Belastung beim Spitalpersonal ist gross, das Spital Region Oberaargau will nun Gegensteuer geben. Um das gleiche Angebot in gleicher Qualität wie zuvor anbieten zu können, braucht es in Zukunft Kreativität. Timo Thimm vom SRO sagt: «Wir müssen gewisse starre Denkweisen ablegen und neue Wege gehen.» Per Dezember wird ein erster solcher Versuch gestartet.
Es ist eine Aussage, die in der aktuellen Zeit nicht überrascht. Timo Thimm, Leiter der medizintechnischen Dienste und der Akutpflegestation im Spital Region Oberaargau, sagt: «Wir sind am Limit. Könnten wir mehr Personal einstellen, dann würden wir es tun.» Die hohe Belastung des Spitalpersonals sei in mehreren Situationen spürbar. In Teamsitzungen wird sie zum Ausdruck gebracht, krankheitsbedingte Ausfälle mehren sich und insbesondere administrative Arbeiten hinken oft hinterher, weil andere Arbeiten höhere Prioritäten geniessen. Auch deshalb musste das SRO zwischen Mai und Oktober die Anzahl Betten reduzieren, um überhaupt noch betriebsfähig zu sein, seit dem 17. Oktober schafft das vorhandene Personal «gerade so» die Vollbelegung mit über 130 Betten auf den verschiedenen Abteilungen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage bei den Mitarbeitenden habe zwar gezeigt, dass die Stimmung verglichen mit anderen Spitälern zwar noch gut sei, auch wird festgestellt, dass die Einsatzbereitschaft wirklich gross und spürbar sei, erklärt Thimm weiter, die (zu) hohe Belastung nehme man aber sehr ernst. «Die Situation hat sich auch akzentuiert, weil in diesem Jahr das Sommerloch weggefallen ist», sagt Lena Wilhelm, Ressortleiterin der Akutpflege. Während in anderen Jahren die Arbeitsbelastung im Sommer tiefer war, habe man davon nun nichts gespürt, schliesslich mussten sogar noch Betten abgebaut werden, weil Personal und nicht etwa Patienten fehlten. «Während wir früher vorausplanen konnten, konzentrieren wir uns aktuell darauf, von Tag zu Tag zu planen.» Dass die Belegschaft weiterhin eine grosse Flexibilität zeige und einspringe, wo immer es möglich sei, mache sie stolz, sagen die beiden. Die Dankbarkeit gegenüber dem Personal sei dementsprechend wirklich gross.
Wertschätzung ist wichtig
Marktübliche Lohnanpassungen werden zwar gemacht, darüber hinaus sind dem SRO aber die Grenzen der Rentabilität gesetzt. Umso mehr will das Langenthaler Spital auf sogenannte Soft-Faktoren eingehen. «Die Wertschätzung von Vorgesetzten ist ein wichtiges Thema. Wir sind froh, dass wir unsere Mitarbeitenden haben. Wir sind stolz auf sie. Das versuchen wir immer wieder zu betonen.» Natürlich brauche es auch einen angemessenen Lohn, abgesehen davon versuche man aber explizit das Zusammengehörigkeitsgefühl zu steigern. «Auch ich war in letzter Zeit zwischendurch wieder im OP, um Kollegen zu entlasten», nennt Timo Thimm ein Beispiel. Das hebt zwar die Moral, ändert aber nicht viel daran, dass sich seit Jahresbeginn rund 2500 Überstunden bei etwa 200 Mitarbeitenden angesammelt haben. Über 100 Dienste wurden zudem kurzfristig, beispielsweise wegen krankheitsbedingten Ausfällen, vom bestehenden Personal übernommen, um den Betrieb sicherzustellen.
Dass das SRO im vergangenen September gleich mehrere Lehrabgänger behalten konnte, habe die Lage immerhin ein bisschen entspannt. Allgemein sei es aber sehr schwierig, neues Personal zu rekrutieren. «Der Markt ist ausgetrocknet», sagt Timo Thimm und meint damit nicht nur jenen in der Schweiz. Denn: «Früher konnten wir, wenn wir Engpässe hatten, auf deutsche Fachkräfte zurückgreifen, die gerne in die Schweiz kamen. Das ist aber nicht mehr ganz so einfach.» Das liege nicht zuletzt auch an der Bezahlung, die in Deutschland etwas verbessert wurde.
Mitarbeiter-Pool zur Entlastung
Dass sich diese Ausgangslage zeitnah ändert, ist kaum realistisch. Auch deshalb will das SRO neue Wege gehen. Als erster Schritt wurde nun ein Mitarbeiterpool gegründet, um an zusätzliches Personal heranzukommen. «Die Idee ist, dass die Mitarbeitenden uns sagen, wann sie Zeit haben, um zu arbeiten und wir entscheiden dann, wo wir sie ihren Fähigkeiten entsprechend einsetzen wollen», sagt Lena Wilhelm. Ein Aufgebot braucht es aber nicht, denn: «Wer Zeit hat, darf automatisch kommen.» Oder anders gesagt: Die angebotene Arbeitszeit ist direkt garantiert. Bevor nämlich zusätzliche Arbeitseinsätze abgelehnt werden, wird eher dem allgemeinen Personal das Kompensieren von Überzeit ermöglicht, um Energie zu tanken.
Aktuell befinden sich fünf Personen in diesem Mitarbeiterpool, der erste solche Arbeitseinsatz sollte am 1. Dezember stattfinden. «Das Ziel wäre es natürlich, 20 oder mehr Personen in diesem Pool zu haben. So können wir sicherstellen, dass wir bei Engpässen genügend Personal haben», sagt Timo Thimm. Dementsprechend wird nach weiteren potenziellen Mitarbeitenden für dieses Angebot gesucht. «Gerade für Rückkehrer oder Mütter kann dieses Angebot interessant sein. Wenn beispielsweise nur eingeschränkt Zeit vorhanden ist, richten wir uns nach ihnen», sagt Lena Wilhelm. In den kommenden Tagen werden diesbezüglich noch vereinzelt Dossiers geprüft, weitere Bewerbungen für den Mitarbeiterpool nimmt das SRO aber weiterhin nur zu gerne entgegen. Als Anreiz wird ein Arbeitseinsatz, neben dem Stundenhonorar, mit einem Beitrag von 100 Franken entschädigt.
Mehr Teilzeit und familienfreundlicher
Ein weiteres Projekt, das sich noch in der Vorbereitungsphase befindet, ist der sogenannte «Familien-OP». Dieser OP wird nur zu gewissen Zeiten in Betrieb sein, in denen beispielsweise Familienväter oder -mütter Zeit haben, weil ihre Kinder in der Schule oder dem Kindergarten sind. «Auf diese Weise würde ermöglicht, dass Mitarbeitende weniger Stunden pro Tag arbeiten müssen.» Die Etablierung eines solchen Angebotes sei aber nicht nur einfach, auch weil starre Denkweisen weiterhin vorherrschen. «Teilzeit ist bei uns noch eher weniger ein Thema», sagt Timo Thimm und begründet dies mit der Rund-um-die-Uhr-Abdeckung. «Wir haben täglich drei Schichten. Wenn jemand nur 50 Prozent arbeitet, brauchen wir zwei Personen für eine Schicht. Das sorgt dafür, dass wir doppelt so oft eine Übergabe machen müssen und hier befürchten viele einen Qualitätsverlust gegenüber den Patienten.» Die Frage stelle sich aber, ob ein Mitarbeiter, der ausgelaugt und müde ist, nicht doch besser durch zwei Mitarbeitende ersetzt wird, die bei erhöhtem Aufwand immerhin gesünder und ausgeruhter sind.
Sich neu erfinden – das sei selbst nach der Covid-Krise, welche eine hohe Flexibilität vom Personal forderte, nicht einfach. «Manchmal bedeutet es, dass wir einfach mal machen müssen. Einfach mal etwas Neues testen», sagt Timo Thimm. Das wolle man künftig mehr tun, um die Personalknappheit zu bekämpfen. Derweil wolle man aber eines nicht vergessen, sagt Lena Wilhelm: «Wichtig ist es auch, nicht nur neue Arbeitskräfte zu suchen, sondern auch zu den bestehenden Arbeitskräften Sorge zu tragen.» Ein offenes Ohr könne hier schon helfen, allgemein habe auch hier wieder vieles mit Dankbarkeit zu tun. Und diese wolle man auch weiterhin gegenüber den Mitarbeitenden so oft wie nur möglich zeigen.
© Unter Emmentaler
Sie sprach als eine der Ersten über Essstörungen
Julian Perrenoud
Pionierin zurück in Langenthal - Bettina Isenschmid leitet das neue Zentrum für Essstörungen und Adipositas im Spital Region Oberaargau. Sie erwartet eine hohe Nachfrage - auch wegen der Pandemie.
In ihrem Büro auf dem umgestalteten früheren Bettenstockwerk wirkt Bettina Isenschmid entspannt, als sie an diesem Nachmittag zum Gespräch lädt. Der Flur ist noch menschenleer. Das dürfte sich in den nächsten Tagen ändern. Denn ab sofort ist das neue Zentrum für Essstörungen und Adipositas im Spital Region Oberaargau (SRO) offen, schon bald werden hier die ersten Patientinnen und Patienten behandelt. Dass Bettina Isenschmid diese Abteilung leitet, ist kein Zufall und hat eine Vorgeschichte, die ihren Anfang in den 90er-Jahren im Berner Inselspital nahm. Als Oberärztin wollte sie in der Psychiatrischen Universitätspoliklinik eine spezialisierte Sprechstunde für Essstörungen einführen. Ihre damals vorwiegend
männlichen Arbeitskollegen fragten sich: Braucht es so etwas überhaupt? Schweizweit gab es damals noch kein vergleichbares Angebot. Bettina Isenschmid glaubte an die Nachfrage. Und sie sollte recht behalten. In kürzester Zeit stieg die Zahl der Sprechstunden stark an. Das Unispital in Zürich und weitere Kliniken folgten ihrem Beispiel. Vor allem Mädchen und junge Frauen meldeten sich.
Ein reines Frauenleiden also? Diese Schlussfolgerung wäre zu einfach.
Das Thema Ernährung begleitet Bettina Isenschmid seit vielen Jahren. Bereits früher, als sie Ballettstunden nahm, wurde sie damit konfrontiert, wie Mädchen versuchten, sich für eine gute Figur runterzuhungern, um den Trainerinnen zu gefallen. Die Oberaargauerin studierte später Medizin, promovierte, liess sich zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie weiterbilden und schulte sich schliesslich in psychosozialer Medizin und Psychosomatik.
Vor ihrer Zeit am Inselspital arbeitete Bettina Isenschmid bereits einmal im SRO in Langenthal. Der Region blieb sie auch danach verbunden: Seit 25 Jahren führt sie in Aarwangen eine Praxis.
Betroffene sind oft zu zögerlich
Vor ihrer Rückkehr an die alte Wirkungsstätte brachte sie ihre berufliche Laufbahn zum Spital in Zofingen. Hier konnte sie eine neue Klinik für Essstörungen aufbauen. «Schon damals hatten wir viele Patientinnen aus dem Oberaargau», blickt die heute 59-Jährige zurück. Es kam zu Wartezeiten von bis zu einem halben Jahr. Und sie fügt an: «Lange war in der Schweiz die Tragweite von Essstörungen nicht bekannt.» Das Thema: tabuisiert. Anders in Deutschland, England oder den USA, wo Behandlungen bereits möglich waren. Hierzulande warteten Betroffene oder Angehörige oft lange, bis sie Hilfe suchten. Zu lange.
Denn bei Essstörungen oder Adipositas spielt der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. «Leidet eine Person bereits seit drei, vier Jahren darunter, verringern sich die Heilungschancen zunehmend», warnt Isenschmid.
Auch deshalb weise etwa die Magersucht mit bis zu zehn Prozent eine äusserst hohe Todesrate auf.
Zwar seien Frauen eher anfälliger für Verhaltenssüchte als Männer, sie könnten also rascher Essstörungen entwickeln. «Trotzdem erklärt das nicht die Diskrepanz, die wir bis heute vorfinden.» Neun von zehn Personen, die sich meldeten, seien nämlich Frauen. Ihre Vermutung: Männer trauten sich seltener, Hilfe zu suchen.
Offene Türen im Oberaargau
Galten Essstörungen lange als unerforschtes Terrain, gibt es heute Fachzeitschriften und Untersuchungen, die sich mit der Ausprägung und dem Verlauf dieser Krankheit befassen. Daher weiss Bettina Isenschmid:
«Nur ein Drittel erholt sich in jungen Jahren davon, zwei Drittel altern mit ihrer Krankheit.» So behandelt sie heute auch 40- bis 50-Jährige, teilweise mit fortgeschrittenen Organschäden.
Im Frühling 2022 hatte Bettina Isenschmid die Idee, in Langenthal ein neues Zentrum aufzubauen. Die Lage nahe an drei Kantonsgrenzen schien ihr ideal, zudem es bisher kein solches Angebot im Oberaargau gab. Ein letztes grosses Projekt vor der Pensionierung sollte es werden. Bettina Isenschmid fragte an und stiess auf offene Türen. «Ich war erstaunt, wie rasch das SRO dieses Anliegen aufgenommen hat.»
Im Spital Zofingen befanden sich laufend zwischen 800 und 1000 Patientinnen und Patienten in Behandlung, in Langenthal erwartet die neue Chefärztin ähnliche Zahlen.
Ein Ereignis hat die Situation noch zugespitzt: die Corona-Pandemie. Diese habe wie ein Vergrösserungsglas gewirkt. Betroffene mussten zu Hause bleiben, konnten teilweise keine Behandlungstermine wahrnehmen - oder dann nur mit Maske oder via Video. Für die Psychotherapie sei das schwierig, sagt Bettina Isenschmid.
Zudem kamen vermehrt andere Suchtverhalten dazu, etwa krankhaftes Fitnesstraining. «Die Pandemie hat verdeutlicht, wie gross das Problem wirklich ist.»
Die Behandlung dauert lange
Das Spital Region Oberaargau will einen ambulanten und somit niederschwelligen Zugang anbieten, um Essstörungen oder Adipositas zu behandeln. Einige Fachpersonen aus Zofingen haben Bettina
Isenschmid nach Langenthal begleitet, dort wird sich nun ein bereits eingespieltes Team aus sechs Personen mit dem Essstörungsbereich befassen. Betroffene, Angehörige oder Dritte können sich entweder
direkt beim Spital oder via Hausarzt melden. Die Grundversicherung der Krankenkasse deckt diese integrative Behandlung ab. Das heisst, Patientinnen und Patienten werden individuell in mehreren Bereichen behandelt. Etwa mit Psychologie, Psycho- und Physiotherapie oder sogar Einkaufstraining.
Bettina Isenschmid gibt zu bedenken, dass eine Behandlung etwa zwei Jahre dauert - oder auch mehr. «Es braucht lange, um eine Essstörung zu beheben.» Das sei nicht anders als in der Suchtmedizin.
Die Chefärztin hat in ihrem Beruf viel erlebt, etwa auch, dass zu Beginn in der Psychiatrie nur Männer den Chefarztposten bekleideten. Das habe sich verändert. «Heute sind wir überwiegend weiblich aufgestellt», sagt Bettina Isenschmid.
Viele, die sich im Gesundheitswesen mit Essstörungen befassen, tun dies bereits ähnlich lange wie sie. Junge Ärztinnen und Ärzte sind schwer zu finden, viele springen nach kurzer Zeit wieder ab. «Nur bei
wenigen weckt es Lust, mit diesem Leiden zu arbeiten», glaubt Bettina Isenschmid. Sie aber fasziniert das Thema. Trotz Pflichten als Mutter und Grossmutter ist sie geblieben. Und setzt nun ihr letztes grosses Projekt um. Sie habe stets viel gearbeitet, sei glücklicherweise gesund geblieben und in Partnerschaft sowie Familie gut aufgehoben. «Vielleicht», sagt Bettina Isenschmid und lacht, «hatte ich es dank meines Pioniergeistes etwas einfacher, aufzusteigen und all dies zu tun.»
© Berner Zeitung Langenthaler Tagblatt
Drohende Energiekrise im Winter - Das Spital Region Oberaargau ist auf eine Mangellage vorbereitet. Der Spielraum aber ist klein, da hilft nicht einmal die moderne Infrastruktur.
Julian Perrenoud
Wer sich durch ein Spital bewegt, will sich eigentlich gar nicht richtig auskennen – ausser er oder sie arbeitet hier. Doch selbst viele Angestellte wissen wenig bis nichts über das Labyrinth, das sich unter oder über ihnen erstreckt, um die Infrastruktur ununterbrochen mit Wärme und Strom zu versorgen.
Die drohende Energieknappheit könnte diesen Winter besonders kritischen Infrastrukturen zu schaffen machen. Dazu gehören auch die Regionalspitäler wie jenes in Langenthal. Von explodierenden Kosten ist in der Branche die Rede, von Notfallszenarien, sollten Gaslieferungen ausbleiben und Stromanschlüsse tot sein. Doch was heisst das genau? Und wie gehen die Betroffenen mit dieser Situation um? Marcel Geisseler schreitet durch einen Tunnel, der die Hauptstrasse am nordöstlichen Stadtende unterquert, weg vom Spital Region Oberaargau (SRO). Dicke Rohre ziehen sich der Wand entlang, es knattert und zischt von der Wärme, die sich in ihnen ausdehnt. Geisseler ist Leiter Technik, Bau und Infrastruktur beim SRO. Er will das unscheinbare Gebäude zeigen, das dafür sorgt, dass das Spital zuverlässig Energie erhält.
Im Notfall reichen die Ölreserven nur wenige Tage
In der früheren Dampfzentrale steht seit 1998 eine Heizanlage. Von hier aus versorgen zwei Heizkessel sämtliche Gebäude des SRO, die so viel Energie verschlingen wie etwa 100 Einfamilienhäuser. Die Anlage arbeitet automatisiert, garantiert konstante 21 Grad im Spital.
Etwas abseits von der Heizanlage befindet sich ein unterirdischer Raum mit einem grösseren und einem kleineren Notstromgenerator. Letzterer könnte beim Ausfall des Ersteren die wichtigsten Bereiche am Laufen halten, wie etwa die Operationssäle. Sollte es zu einem Stromunterbruch kommen, würde nach maximal 15 Sekunden wieder Strom fliessen – und auch dies vollautomatisch. Früher lagerte in diesem Bau unterhalb des Helikopterlandeplatzes eine Million Liter Heizöl in vier Tanks, ein Pflichtlager für Notfälle. Denn sollte einmal das Gas ausbleiben, könnte das Team der Technischen Dienste die Heizkessel innert fünf Minuten auf Öl umrüsten. Heute fasst der verkleinerte Tankraum bloss noch 50’000 Liter.
Als das SRO im Jahr 2010 einen Masterplan definierte, gingen die Verantwortlichen davon aus, dass diese Menge ewig reichen würde. «Man sagte sich: Wir haben ja Gas. Weshalb sollten wir plötzlich kein Gas mehr haben», erzählt Marcel Geisseler. Spätestens seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist klar, was zu einem Engpass führen könnte. Die aktuellen Ölreserven würden für fünf bis sieben Tage reichen, beim Notstrom wären es sogar noch weniger. Die Anlage schluckt je nach Last alleine pro Stunde zwischen 400 und 500 Liter an Heizöl. Zwar gebe es auf der Welt noch genügend Öl, sagt Geisseler. «Doch wer garantiert mir, dass ich dieses innerhalb von zwei Tagen erhalte?» Deshalb hat das SRO bei einem Lieferanten 300’000 Liter auf Garantie reserviert.
Bleibt also nur noch, Energie zu sparen. Doch wie weit kann ein Regionalspital überhaupt gehen? Das SRO hat in den vergangenen Jahren viel Geld investiert und die meisten Gebäudetrakte saniert, Dächer, Wände und Fenster isoliert. «Wir sind ausser einem Ärztehaus auf dem neusten Stand», sagt Geisseler.
Auch im Sommer muss geheizt werden
Doch auch ein Neubau oder ein saniertes Spital benötigt nach wie vor grosse Mengen an Strom und Wärme. Für Röntgenapparate, Beatmungsgeräte, Technik im Operationssaal oder die umfangreiche IT. Selbst im Sommer müssen die OP-Säle hochgeheizt und wieder runtergekühlt werden, damit die Luft genügend trocken ist und so den hygienischen Vorschriften entspricht. Bei Operationen erfüllt auch die Lüftung eine zentrale Aufgabe. In anderen Gebäudeteilen kann diese aber
reduziert werden, wie Thomas Geiser sagt. Er leitet den Technischen Dienst und inspiziert regelmässig die Abzüge, die sich in einem Gebäudeteil oberhalb des OP-Bereichs befinden. Jeder einzelne Spitalsaal wird von hier aus belüftet.
Im Nebenraum der Lüftungsanlagen steht eine Dampfzentrale, die für die Sterilisation ihre Dienste leistet. Diese wir ebenfalls mit Gas betrieben. «Ohne Dampf geht es nicht», erklärt Geiser. Bei Gasmangel könnte ein Teil der Geräte auf Elektro umschalten.
Beim Licht kann man noch sparen
Was das SRO weiter tut: Es rüstet auf LED-Beleuchtung um oder prüft automatische Nachtlichtabsenkungen in den Korridoren. Am Bettenhochhaus gibt es erstmals keine Weihnachtsbeleuchtung. «Wir erinnern auch alle Mitarbeitenden daran, Strom zu sparen», betont Marcel Geisseler. Doch für ein Regionalspital sei der Spielraum beschränkt. Zumal das SRO noch drei Aussenstandorte in Herzogenbuchsee, Huttwil und Niederbipp betreibt, die zusammen nochmals halb so viel Energie zusätzlich wie der Standort in Langenthal verbrauchen. Die gesamte Organisation umfasst jährlich etwa 8600 stationäre Patientinnen, 49’000 ambulante Patienten und 1300 Mitarbeitende.
Beim Strom profitiert das Spital von laufenden Verträgen, beim Gaspreis jedoch rechnet es mit einer Verdoppelung. Die Fotovoltaik-Anlage auf dem 2019 erstellten Parkhaus deckt nur etwa ein Zehntel desStrombedarfs ab.
Der Technische Dienst erwartet, dass die aktuelle Mangellage keine kurzfristige Erscheinung ist. Deshalb prüft das SRO zusammen mit der Energiedienstleisterin IB Langenthal, die über 20-jährige Heizzentrale durch einen Wärmeverbund zu ersetzen. Schnitzelheizung statt fossile Energie. Bereits in vier Jahren könnte es so weit sein, prognostiziert Marcel Geisseler. Bis dahin muss das Regionalspital mit jenen Mitteln auskommen, die ihm zur Verfügung stehen. Hauptsache, der Betrieb wird am Laufen gehalten. Ob mit Gas oder Öl.
© Berner Zeitung Langenthaler Tagblatt
Das SRO Gesundheitszentrum in Huttwil möchte sich weiterentwickeln. Aus diesem Grund werden ab nächstem Jahr bis Ende 2025 umfassende Umbauarbeiten am und im Gebäude wie auch bei den Abteilungen der dahlia oberaargau ag vorgenommen. Zudem werden neue Alterswohnungen und -studios entstehen. Das Angebot der Sprechstunden und Therapien bleibt wie gewohnt bestehen.
Marion Heiniger
Beim SRO Gesundheitszentrum in Huttwil tut sich wieder etwas. Der Umbau des ehemaligen Personalhauses ist seit Längerem abgeschlossen. Seit 2020 ist dort die Kindertagesstätte der KIBE Region Huttwil AG eingemietet. Auch die Landschaftsarbeiten rund um das Gesundheitszentrum sind seit Sommer 2019 fertiggestellt. Nun haben die Verantwortlichen, ihnen voran Daniel Wellinger (seit vier Jahren Leiter der drei SRO-Gesundheitszentren Huttwil, Herzogenbuchsee und Niederbipp), in Huttwil weitere Umbaumassnahmen in Planung. Das Gesundheitszentrum beabsichtigt die komplette Sanierung des gesamten Gebäudes sowie den Umbau der Dahlia Abteilungen.
Moderne und attraktive Einer-Zimmer
60 Prozent des SRO Gesundheitszentrums Huttwil werden von der dahlia oberaargau ag genutzt. Sie bietet rund 55 älteren Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf Platz. Mit dem Umbau entstehen in den bisherigen Räumlichkeiten der dahlia oberaargau ag moderne und attraktive Einer-Zimmer mit integrierter Nasszelle. Zudem werden die Arbeitsräume für das Betreuungs- und Pflegepersonal mit Blick auf die Betriebsabläufe möglichst optimal positioniert. Die bisherigen Angebote der SRO, Sprechstunden und Therapien, die allgemeine Innere Medizin, Chirurgie, Ergotherapie, Gynäkologie, Physiotherapie, Wundambulatorium und Psychiatrisches Ambulatorium, werden während Und auch nach dem Umbau
bestehen bleiben. Genauso wie die externen Anbieter und Partner wie das Augenzentrum, die Hörberatung, das Osteomobil und dieTCM Oberaargau (Traditionelle Chinesische Medizin).
«Wir könnten uns auch vorstellen, das bereits umfassende Angebot in der Zukunft noch weiter auszubauen», stellt Daniel Wellinger in Aussicht. Die Hausarztpraxis von Roland Baumann, der kurz vor seiner Pensionierung steht, wird noch bis Ende Jahr weiter betrieben. Diese Dienstleistung wird jedoch künftig nur noch den Bewohnern vor Ort angeboten. Nach der Pensionierung von Roland Baumann wird ein Heimarzt der SRO AG Langenthal in den Praxisräumlichkeiten des Gesundheitszentrum Einzug nehmen. Die Heimarztpraxis wird anfangs 2023 in die Nähe des Patientenempfangs im Erdgeschoss umziehen.
Alter Spitaleingang wird reaktiviert
Der alte Teil des ehemaligen Huttwiler Spitals, welcher bisher Sprechstunden und Therapien Vorbehalten war, wird künftig nur noch durch die dahlia obcraargau ag genutzt. Hier entstehen Studio- und Alterswohnungen, in denen ältere Personen, welche ihr Leben noch selbst bestreiten können, Einzug nehmen dürfen. «Hierbei möchten wir in Zukunft mit der Spitex, die vor Jahren das ehemalige Schwesternhaus gekauft hat, Hand in Hand arbeiten», erklärt der Leiter der Gesundheitszentren. Die Langzeitpflegeplätze werden auch nach dem Umbau im neuen Gebäudeteil bleiben. Damit während den Umbauarbeiten, welche frühestens 2023 beginnen und voraussichtlich bis Ende 2025 dauern, der laufende Betrieb nicht gestört wird, wird der alte Spitaleingang wieder reaktiviert. Auch nach den Umbauarbeiten wird der alte Eingang bestehen bleiben. Um während der Umbauphase einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, wurde im Untergeschoss des neuen Gebäudeteils schon mit den Umbauarbeiten begonnen. Dorthin werden in Kürze das Augenzentrum, die Wundbehandlung und Chirurgie sowie die Wirbelsäulen-Medizin umziehen. Die Psychiatrischen Dienste werden Ende September ihre Räumlichkeiten im Untergeschoss beziehen. Im Erdgeschoss des neuen (Spital-)Teils werden nach wie vor die Behandlungsräume der TOM und die Physiotherapie zu finden sein. Neu werden dort auch die Gynäkologische Sprechstunde der SRO AG (Umzug geplant im Oktober) und die Hörberatung (Umzug geplant im November) ihren Platz finden. Wie im Untergeschoss wird auch hier das düstere Grün an den Wänden einer hellen und freundlichen weissen Farbe weichen. Lediglich einem sanften Umbau wird das Restaurant «Chestele» im Untergeschoss unterzogen. Obwohl noch einige administrative Hürden vor den Umbauarbeiten zu meistern sind, hofft Wellinger, dass der Startschuss wie geplant nächstes Jahr fallen kann.
© Unter-Emmentaler
Bettina Isenschmid wechselt vom Spital Zofingen zur Spitalregion Oberaargau. Die Ernährungsmedizinerin wird im Spital Langenthal neue Chefärztin des Zentrums für Essstörungen und Adipositas.
Nach über zehn Jahren Tätigkeit am Spital Zofingen übernimmt Bettina Isenschmid die Funktion als Chefärztin bei der Spitalregion Oberaargau in Langenthal. Sie wird ab dem 1. Oktober 2022 Chefärztin des neu konstituierten Zentrums für Essstörungen und Adipositas (ZESA), wie sie gegenüber Medinside bestätigt. Isenschmid ist Psychiaterin und hat seit 2009 das Kompetenzzentrum für Essverhalten, Adipositas und Psyche (KEA) im Spital Zofingen geleitet. In ihrer beruflichen Karriere war sie unter anderem Oberärztin in der Psychiatrischen Universitätspoliklinik und Kaderärztin Kompetenzbereich Adipositas, Ernährungspsychologie und Prävention von Essstörungen am Inselspital Bern.
Häufig in den Medien zitierte Ernährungsmedizinerin
Bettina Isenschmid ist seit mehreren Jahren in einer psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis in Aarwangen tätig und arbeitet seit 2011 als freie Mitarbeiterin am Institut für Hausarztmedizin der Universität Bern. Die Ärztin ist unter anderem im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Essstörungen. Zudem ist sie Gründungsmitglied der SGPPM, der Gesellschaft für Psychosoziale und Psychosomatische Medizin. Die Psychiaterin wird in den Medien häufig als Expertin rund um das Thema Ernährungsmedizin zitiert. Sie verfügt über Lehraufträge und -tätigkeiten an verschiedenen Hochschulen und Fachhochschulen in den Bereichen Essstörungen, Adipositas, Psychische Erkrankungen, Ernährung und Diätetik, Sozial- und Heilpädagogik. Isenschmid hatte in Bern studiert und ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Master of Medical Education und verfügt über einen Weiterbildungstitel in Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie.
© Medinside

Im Geburtshaus Viola gebären gesunde Frauen mit problemlosen Schwangerschaften, die einen anderen Rahmen für die Geburt wünschen als im Spital. Christa Gutknecht, leitende Hebamme, Geburtshaus Viola Langenthal über das neue Angebot des Spitals Region Oberaargau SRO.
Das Geburtshaus Viola im Spital Region Oberaargau SRO wurde kürzlich eröffnet. Welche Idee steckt dahinter?
Christa Gutknecht: Das Angebot des Geburtshauses ist ein zusätzliches Angebot der Frauenklinik am SRO, dass Frauen und ihren Familien offensteht, die sich für eine Alternative zu Hausgeburt und Spitalgeburt interessieren. Im Geburtshaus findet kontinuierliche Hebammenbetreuung durch eine Beleghebamme statt. Eine Ärztin oder ein Arzt ist bei der Geburt nicht anwesend. Die Idee ist es, in den zwei Räumen, in denen keine medizinischen Geräte herumstehen, in ruhiger und vertrauter Atmosphäre, ähnlich wie bei einer Hausgeburt zu gebären. Dies in nächster Nähe zum erfahrenen medizinischen Personal der Frauenklinik des SRO, falls doch eine Intervention notwendig sein sollte. «So wenig wie möglich, so viel wie nötig» ist die Idee, die hinter dem Angebot steckt.
Wie sieht das Angebot des Geburtshauses Viola aus?
Im Geburtshaus Viola gebären gesunde Frauen mit problemlosen Schwangerschaften, die einen anderen Rahmen für die Geburt wünschen als dies das SRO bisher bieten konnte. Im Geburtshaus betreut eine Beleghebamme die werdende Familie bereits in der Schwangerschaft, während der Geburt und im Wochenbett. Die kontinuierliche Betreuung bietet einen vertrauten und intimen Rahmen für die kommende Geburt. Auf routinemässige Spitalabläufe und Überwachungen wird verzichtet, auf starke Medikamente ebenso. Die Hebamme begleitet und überwacht Mutter und Kind ähnlich wie bei einer Hausgeburt. Dass sich Familie und Hebamme bereits kennen, fördert eine gute Zusammenarbeit und das Vertrauen ineinander. Die Hebamme kennt die werdende Familie und ihre Bedürfnisse und begleitet sie dementsprechend. Zur Geburt kommt eine zweite Hebamme hinzu. Dies alles findet wie erwähnt in nächster Nähe zum Gebärsaal der Frauenklinik statt. Wird doch wider Erwarten medizinische Unterstützung benötigt, ist sie rasch für Mutter und Kind verfügbar. Auch die ersten Wochenbetttage können im Geburtshaus verbracht werden.
Im Zentrum steht die fortwährende Hebammenbetreuung, welche individuell und nahe ist. Wie unterstützen Sie die schwangeren Frauen konkret?
Dadurch, dass das Geburtshaus Viola in anderen Räumlichkeiten untergebracht ist als die restliche Frauenklinik und die Einrichtung nicht der gängigen Spitaleinrichtung entspricht, empfängt bereits dadurch eine andere Atmosphäre die werdenden Eltern. Sie werden von der bereits aus der Schwangerschaft vertrauten Beleghebamme betreut, die ihre Bedürfnisse und Wünsche kennt und wahrnimmt. Da ausser der Beleghebamme einzig eine Zweithebamme zur Geburt dazukommt, ist die Intimsphäre der werdenden Mutter optimal gewährt, was das Geburtsgeschehen oft begünstigt, da nichts den natürlichen Verlauf stört. Die Gebärende soll sich nach ihren Bedürfnissen bewegen, kann ein Bad nehmen, bekommt eine Massage, gerade so, wie es ihr im Moment guttut. Dabei wird sie von Partner oder Partnerin und Hebamme getragen.
Was machen Sie anders im Geburtshaus Viola?
In der Schweiz gibt es bereits ein paar andere solche spitalnahen Angebote für die Geburt, die ähnlich funktionieren. Das Rad wurde also in Langenthal nicht neu erfunden, fand aber rasch Unterstützer wie den Chefarzt Dr. Daniele Bolla. Das Angebot ergänzt das übliche Angebot des Spitals und soll die Nachfrage der Frauen nach einem natürlichen Geburtserlebnis, aber auch einem Sicherheitsbedürfnis, das durch die Spitalnähe gegeben ist, erfüllen. Beide Angebote, Geburtshausund Spitalgeburt zielen darauf ab, Mutter und Kind optimal zu begleiten und gesund ins Leben ziehen zu lassen.
Welche Frauen kommen ins Geburtshaus Viola?
Da das Geburtshaus erst gestartet hat, können wir dies noch nicht allgemein benennen. Es sind aber bisher Frauen, die den Wunsch haben, ihr Kind ohne unnötige Interventionen und in ruhiger Umgebung gebären zu können. Es sind Frauen, die sich intensiv mit der kommenden Geburt auseinandersetzen und sich bewusst und gut informiert für diesen Schritt entscheiden, gemeinsam mit ihrem Partner oder Partnerin.
Was sind heute die grössten Herausforderungen für eine werdende Mutter?
Für werdende Mütter gibt es heutzutage so viel Angebote, Ratschläge und Informationen, dass es für sie oft herausfordernd ist, das Richtige für sich zu finden. Tausende Ratschläge im Internet verunsichern die Schwangeren oft mehr als dass sie helfen würden. Deshalb empfehlen wir den Kontakt zu Fachpersonen bereits in der Schwangerschaft und entsprechende Beratung, so dass jede Frau das für sie passende Angebot findet.
Was wünschen Sie sich für das Geburtshaus Viola?
Wir durften bereits am 13. Juni das erste Kind, das im Geburtshaus Viola unter der kundigen Begleitung von Beleghebamme Zuzka Hofstetter zur Welt kam, begrüssen. Sie heisst Alissa Strahm und hatte eine ganz unkomplizierte Geburt, die problemlos und sicher im Geburtshaus begleitet werden konnte. Wir wünschen uns für die Zukunft noch mehr solche tolle Familien wie die ihre, die sich in der Umgebung des Geburtshauses wohlfühlen und ihre Kinder in diesen Räumen gebären wollen.
© Langenthaler Zeitung, Oberaargauer Zeitung



Mit der Psychiatrie auf Hausbesuch - Weil der Psychiatrie im Oberaargau Klinikplätze fehlen, werden Patienten und Patientinnen auch zu Hause betreut. Das hat durchaus Vorteile.
Kathrin Holzer
Die Begrüssung ist freundschaftlich, die Situation wirkt vertraut. Ohne viele Worte nehmen Nina Ziegler und Lisa Bay Platz am grossen Stubentisch.
Den Notizblock legt die Psychologin Ziegler erst einmal neben sich auf den Tisch. Die Pflegerin Bay klappt derweil den Laptop auf. Stille.
«Gestern habe ich kein Ventil gebraucht», sagt plötzlich Simone B. (Name geändert), die den beiden Besucherinnen gegenübersitzt. Wieder Stille. Ein kurzes Lächeln. «Aber ja, es bleibt turbulent.»
Nina Ziegler und Lisa Bay verstehen offenbar sofort. «Was meinen Sie, was muss weniger werden?», fragt die Psychologin die junge Frau mit ruhiger Stimme. Allmählich nimmt das Gespräch an Fahrt auf.
Die Szene, die sich an diesem frühen Abend in einem Wohnzimmer im Oberaargau abspielt, ereignet sich in ähnlicher Form täglich auch in anderen Haushaltungen zwischen Seeberg und Roggwil, Farnern und Rohrbachgraben.
In vertrauter Umgebung
Im ganzen Verwaltungskreis sind Mitarbeitende der Psychiatrie der Spital Region Oberaargau (SRO) AG täglich unterwegs,
um Menschen mit psychischen Erkrankungen direkt daheim in deren vertrauter Umgebung zu unterstützen.
Mobile Akutbehandlung nennt die SRO ihr vor bald zwei Jahren eingeführtes Angebot, das in Fachkreisen unter dem Namen Home Treatment bekannt ist und zunehmend Schule macht.
Die Spitalregion hat damit auf ein bereits länger anhaltendes Problem reagiert: auf die fehlenden Behandlungsplätze im stationären Bereich und die damit einhergehende konstante Überlastung des Angebots.
36 Patientinnen und Patienten könne die SRO-Psychiatrie auf ihren beiden Stockwerken im Spital in Langenthal jeweils aufnehmen, erklärt Chefarzt Manuel Moser.
Die Nachfrage nach einer stationären Behandlung ist aber weit höher. Mehr als die Hälfte aller psychisch erkrankten Oberaargauerinnen und Oberaargauer mussten deshalb bis vor zwei Jahren auf Kliniken ausserhalb ausweichen.
Ein Strategiewechsel
Die SRO-Verantwortlichen hatten sich bereits mit Ausbauplänen befasst. Doch dann entschied man sich für einen Strategiewechsel: Statt die Menschen in die Klinik zu holen, soll diese zu den Betroffenen nach
Hause kommen. 16 zusätzliche Behandlungsplätze wurden so geschaffen. Damit kann die SRO inzwischen immerhin knapp zwei Drittel ihrer Patientinnen und Patienten mit dem eigenen psychiatrischen Akutangebot versorgen.
Die Hausbesuche fielen unter dem Strich nicht nur kostengünstiger aus, hält Chefpsychiater Moser fest. Auch aus medizinischer Sicht seien sie einem Klinikaufenthalt unter bestimmten Voraussetzungen vorzuziehen.
Weil das Problem dann im Umfeld angegangen wird, in dem es entstanden ist und in dem die Betroffenen auch fortan zurechtkommen müssen. Und ebenso, weil mit dem niederschwelligen Angebot
die Hemmung oft kleiner sei, überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Für Simone B. ist die mobile Akutbehandlung längst zu einem wertvollen Anker geworden.
Als dreifache Mutter ist es für sie wichtig, daheimbleiben zu können. Gleichzeitig ist ihr klar: Ohne Hilfe geht es momentan nicht. Nicht zum ersten Mal nimmt sie deshalb das noch relativ junge Angebot der SRO in Anspruch.
Dabei sei sie den Hausbesuchen anfangs sehr skeptisch gegenübergestanden, erzählt sie.
Die Frau ist in ihrem noch jungen Leben schon ein paarmal an ihre Grenzen gestossen. Zu einer schwierigen Vorgeschichte kamen nach der Geburt der ersten beiden Kinder postnatale Depressionen
hinzu und später auch noch der Verlust einer wichtigen Bezugsperson. Immer wieder war Simone B. deshalb in ambulanter Behandlung. Bis erstmals der Punkt kam, an dem diese nicht mehr ausreichte.
Menschen in Not
«Es geht hier um Menschen in Not», erklärt Psychologin Nina Ziegler. Und dieser Not müsse nicht immer eine grundlegende psychische Störung vorausgehen.
«Manchmal müssen bloss verschiedene Faktoren zusammenkommen, damit der Mensch in eine völlige Überlastung gerät.»
Die psychische Erkrankung kann ebenso dem Busfahrer widerfahren, der seine Frau verliert und sich nicht mehr konzentrieren kann.
Der Schulabgängerin mit einer Persönlichkeitsstörung, die zusätzlich unter Prüfungsstress gerät. Oder auch all jenen Menschen, die des Lebens schlicht müde sind.
«Manchmal müssen bloss verschiedene Faktoren zusammenkommen, damit der Mensch in eine völlige Überlastung gerät.» - Nina Ziegler, Psychologin
Patienten aktiv einbeziehen
Der Hausbesuch ermögliche den Therapeutinnen und Pflegern oft einen anderen Blick auf die Betroffenen als im Stationsalltag, sagt der Bereichsleiter Pflege bei der mobilen Akutbehandlung, Giovanni Wildbolz.
Auch würden die Patienten aktiver in die Lösungssuche miteinbezogen. Entsprechend wichtig sei der Austausch im Team: Es wird dabei nicht nur besprochen, welche Kapazitäten gerade bestehen.
Auch die konkreten Fälle werden im Team erörtert, zu dem neben Pflegefachkräften, Therapeuten und Arzt ebenso eine Fachperson aus der Sozialarbeit gehört.
«Es entsteht dadurch ein grosses Schwarmwissen, dank dem wir die unterschiedlichen Situationen und Veränderungen im Verhalten der Patienten erkennen können», sagt der leitende Arzt Karl Zwanzger.
Im Fall von Simone B. sprechen die Fachleute von einer sogenannten Anpassungsstörung: Der Mensch wird durch die Summe verschiedener Dinge dermassen überfordert,
dass er beispielsweise Panikattacken oder Depressionen bekommt. Darunter leidet nicht nur die Patientin selbst. Auch der Partner und die Kinder leiden mit.
Der Einbezug des Umfelds der Patientin sei deshalb ein wichtiges Element in der mobilen Akutbehandlung, sagt Nina Ziegler. Zum Ausdruck kommt das auch an diesem Nachmittag.
«Ein Paargespräch wäre jetzt wichtiger denn je», empfiehlt sie ihrer Patientin. Diese nickt: «Ja, wir müssen wieder miteinander kommunizieren können.»
Es sind bereits vorhandene Strategien, auf die Simone B. und ihre Besucherinnen im Gespräch zurückgreifen können. «Sie zeigen mir den Weg zu mir selbst. Und wie ich aus meiner Not herauskomme»,
sagt die junge Frau. Das bedingt gegenseitiges Vertrauen, das erst einmal aufgebaut werden musste.
«Sie zeigen mir den Weg zu mir selbst. Und wie ich aus meiner Not herauskomme.» - Simone B., Patientin
Was hier und heute vertraut wirkt, fühlt sich offenbar genau so an: «Sie sind für mich wie Freundinnen», sagt Simone B. über ihre Besucherinnen.
«Einfach mit dem Ziel, dass sie bald nicht mehr zu mir kommen.» Das bekräftigen auch Lisa Bay und Nina Ziegler. Vorerst dürften sie oder ihre Kolleginnen und Kollegen
von der mobilen Akutbehandlung aber noch einige Male gemeinsam mit ihrer Patientin am Stubentisch sitzen.
Die durchschnittliche Behandlungsdauer in der mobilen Akutbehandlung sei vergleichbar mit jener in einer Klinik, sagt der Bereichsleiter Pflege, Giovanni Wildbolz.
Durchschnittlich etwa einen Monat lang stünden somit täglich Hausbesuche an. Bei besonderer Not können es auch bis zu vier Besuche an einem einzigen Tag sein.
Bis sich der Patient oder die Patientin allmählich wieder zurechtfindet und die Besuche hinfällig werden.
Anschlusslösungen gefragt
Wichtig seien in dem Moment Anschlusslösungen, sagt Psychologin Ziegler. Simone B. legt sie bereits heute nahe, Kontakt mit dem Rot-Kreuz-Entlastungsdienst aufzunehmen.
«Solche Lösungen sind wichtig, wenn wir einmal nicht mehr da sind.»
Denn ganz ohne Hilfe geht es im Leben vieler Betroffener auch nach der akuten Behandlung nicht. Rückfälle, wie sie Simone B. immer wieder hat,
seien bei psychischen Erkrankungen leider «ein Stück weit Normalität», sagt Giovanni Wildbolz. Und doch sei die Patientin mit jedem Mal einen Schritt weiter als noch beim letzten Mal.
Nach einer knappen Stunde klappt Lisa Bay den Laptop zu, und die beiden Besucherinnen stehen auf. Kurz darauf sitzen sie bereits wieder im Auto und fahren zurück nach Langenthal.
Für heute war Simone B. ihre letzte Patientin. Bereits am nächsten Tag wird die junge Frau neuerlich Besuch erhalten von einem Team der mobilen Akutbehandlung.
So lange, bis sie wieder selbst zurechtkommt und die grösste Not überwunden ist.
Start mit dem Shutdown
Ausgerechnet am 16. März 2020 ging das neue Angebot der mobilen Akutbehandlung der SRO Psychiatrie mit dem ersten Hausbesuch in Betrieb.
Just zu jenem Zeitpunkt also, als der Bundesratwegen der Corona-Pandemie den Notstand ausrief. Das hat irgendwie gerade gepasst.
Nicht etwa, weil die Betten in der stationären Abteilung damals völlig ausgelastet gewesen wären. Am Anfang der Pandemie habe vielmehr eine grosse Skepsis gegenüber einem Klinikeintritt
vorgeherrscht, blickt SRO-Chefpsychiater Manuel Moser zurück.
Patientinnen wie Angehörige hätten sich vor einer möglichen Ansteckung im Spital gefürchtet, aber auch vor einer durch die Pandemie möglicherweise noch verstärkten Abgeschiedenheit.
Entsprechend gross war wohl nicht zuletzt deswegen von Beginn an die Nachfrage nach dem neuen Betreuungsangebot in Form von Hausbesuchen.
Wobei die SRO-Psychiatrie durch die Corona-Pandemie weniger eine Zunahme als vielmehr eine Verlagerung der Fälle registriert habe, sagt Manuel Moser.
So hätten etwa Angststörungen zugenommen. Ebenso litten gerade junge Menschen vermehrt unter Zukunftsängsten.
Viele Ursachen für psychische Erkrankungen seien indes auch vor der Pandemie zunehmend zu beobachten gewesen: wenn die soziale Einbettung fehlt, etwa durch Jobverlust zum Beispiel.
Jährlich rund 350 Fälle werden in der SRO-Psychiatrie stationär behandelt, weitere rund 290 in Tageskliniken. Dazu kommen laut Chefpsychiater Moser infolge eines generellen Ärztemangels
auch um die 4000 Behandlungen im ambulanten Bereich.
© Berner Zeitung



Die SRO AG ist das regionale Spitalzentrum im Oberaargau, Kanton Bern. Das Spital Langenthal und seine zwei Gesundheitszentren in Huttwil und Niederbipp sowie der PanoramaPark in Herzogenbuchsee
bieten eine umfassende und hochwertige medizinische Versorgung für die Bevölkerung der Region.
Total werden 15 stationäre oder ambulante Standorte betrieben. Die SRO besitzt Leistungsaufträge in den Bereichen der Akutversorgung, der Psychiatrie und des Rettungsdienstes.
Ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor ist neben der medizinischen Vernetzung die digitale Vernetzung in der Region sowie mit verschiedenen Partnern überregional.
Die interne Vernetzung und diejenige mit vor- und nachgelagerten Partnern werden immer intensiver. Das ist die Basis für eine erstklassige Zusammenarbeit auf dem ganzen Behandlungspfad,
sichert einen optimalen Ressourceneinsatz und erhöht die Behandlungsqualität. Profiteure sind alle: Mediziner, Pfl egende und Patienten.
Das Netzwerk, das eine einwandfreie und sichere Kommunikation sicherstellt, muss rund um die Uhr verfügbar sein und daher redundant angelegt sein – ohne jegliche Unterbrüche.
Die Ausgangslage in der SRO war eine typische, weil organisch gewachsene: «Es gab verschiedene Standorte mit unterschiedlicher Infrastruk-
tur», berichtet Claudio Somaini, IT-Leiter, «es bestand keinerlei Netzwerk-Segmentiertung. Unser Optimierungsbedarf war gross, so dass wir eine umfangreiche Evaluation nach leistungs-
starken Lösungen starteten. Das Gesamtpaket der HINT AG überzeugte uns dabei am meisten.» Finanzchef Rolf Hayoz doppelt nach:
«Wir wollen sicherstellen, dass parallel zum Neu- und Ausbau unserer Gebäude-Infrastruktur auch die Informationstechnik auf den neusten Standkommt.
Das bedeutet deutlich höhere Kapazitäten und Bandbreiten sowie einen ortsunabhängigen schnellen und sicheren Zugriff auf vielfach sensible Patientendaten.
Ausserdem wollen wir gerüstet sein, um einem weiteren Datenwachstum und anderen Anforderungen, die künftig auf uns zukommen werden, gewachsen zu sein.»
Weil beim Vernetzen wichtige medizinische Geräte mit Vitaldaten von Patienten betroffen sind, bedeutete das für die beauftragte HINT AG, Lenzburg,
hohe Anforderungen ans neue Netzwerk zu erfüllen, da künftig alle Mittel über diese digitale Drehscheibe laufen müssen (Telefonie wie W-Lan).
Es galt, auch die Alarmierung mit einzubeziehen und altmodische Pager durch eine Integration von Tablets und Mobiles zu ersetzen.
Weitere Voraussetzung für die Zukunft war erst einmal die vollständige Digitalisierungder Patientenakten, aber auch der übrigen administrativen Akten.
Eine neue starke Lebensader für das ganze Unternehmen
Aufgrund der grossen und kräftig wachsenden Datenmengen, namentlich der «schweren» Bilddaten, waren hohe Durchsatzraten gefordert.
Das wiederum bedeutete sehr hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. Gleichzeitig musste sichergestellt werden,
dass das medizinische Umfeld einen rascheren Zugriff auf strukturierte Daten für die Entscheidungsfindung wie die Therapie erhielt.
Rolf Hayoz: «Unsere Behandelnden erwarten, dass alle nötigen Daten schnell verfügbar sind, damit sie ihre Patienten optimal versorgen können,
gerade auch im Operationssaal, wo Ausfallsicherheit oberste Priorität geniesst. Was der Behandlungsqualität zugute kommt,
verbessert gleichzeitigauch unsere Prozesse, Effi zienz wie Wirtschaftlichkeit. Schliesslich geht es auch um den Komfort während eines stationären Aufenthalts.
Sowar gewünscht, das neue Netzwerk ebenfalls als Plattform für unsere Patienten einzusetzen – für Entertainment, Kommunikation und private oder geschäftliche Tätigkeiten.»
Eine sorgfältige Segmentierung war zu erstellen, in der das neue Netzwerk die Funktion einer leistungsstarken Ader der Kommunikation und Digitalisierung erfüllen sollte.
Als offenes, zukunftssicheres, flexibles und serviceorientiertes Transportnetzwerk wurde eine moderne Netzwerk-Infrastruktur der Extreme Networks gewählt,
in der Schweiz stark vertreten durch HINT AG, vertrieben. Ralph Jordi, Bereichsleiter Customer Care, bringt es auf den Punkt:
«Extreme Networks ist eine moderne, ausbaubare Netzwerklösung und bietet hohe Sicherheitsstandards, grosse Datenraten und ein sicheres mobiles Arbeiten.
Sie erfüllt zudem die besonderen Anforderungen an W-LAN und Übertragung.»
Bereitstellen vollautomatisierter Netzwerkdienste
Vom neuen Netzwerk profi tieren die BenutzerInnen im Akutspital, in den ambulanten Institutionen wie auch in der Alters- und Pflegebetreuung.
Die einfache Bedienung, die auf eine starke Anerkennung gestossen ist, überzeugt. Positiv bewertet wird von der SRO auch die automatische Geräteerkennung und Benutzung,
und das bei einem 24 Stunden nonstop laufenden medizinischen Betrieb, der auf eine hohe Verfügbarkeit, starke Performance und lückenlose Sicherheit zählen kann.
Zur doppelten Sicherheit kommt der direkte Draht zu den Spezialisten der HINT AG dazu. «Wir nennen das Managed ICT Services», hält
Ralph Jordi fest, «denn wir nehmen die Partnerschaft mit unseren Kunden sehr ernst und bieten diesen rund um die Uhr kompetente
AnsprechpartnerInnen mit ausgeprägter Sozialkompetenz.»
Hinter allen Dienstleistungen der HINT AG stehen versierte Fachleute aus den ICT-Bereichen, die mit den Abläufen und Prozessen in Spitälern, Kliniken, Heimen und Praxen bestens vertraut sind.
Mit durchdachter Organisation, zertifi zierten Prozessen und modernster ICT-Technologie bieten sie umfassende und hochwertige Dienstleistungen für alle ihre Bedürfnisse an.
Dank der 100%-Konzentration auf die Healthcare-Branche ist wie bei keinem anderen Service Provider der Schweiz das erforderliche Knowhow zu den spezifi schen Anforderungen des Schweizer Gesundheitswesens vorhanden.
Dementsprechend professionell und umfassend sind alle Managed ICT Services: von der Beratung zur Evaluation über die Implementierung bis hin zum Betrieb von Service Desks,
Plattformen oder spezifi schen Software as a Service-Dienstleistungen.
Schwungvoll umgesetzt
«Aus dem Know-how und der Erfahrung der HINT-Spezialisten ist die Basis für unser neues Netzwerk entstanden», freut sich Claudio Somaini.
«Insgesamt setzen wir zusammen vier Etappen um: System-Implementierung, Telefonie, mobile Kommunikation und Datenmanagement am Patientenbett.
Wir sind gut unterwegs, weil wir uns ausreichend Zeit für die Vorbereitung genommen haben. Nach einem Jahr sind wir im Betrieb angekommen, wobei drei Sachen zu betonen sind:
Erstens ist es generell ratsam, genügend Zeit für die Vorbereitung wie die Umsetzung zu planen, zweitens muss die schrittweise Umstellung während des Vollbetriebs aller Standorte erfolgen
und drittens fielen viele Arbeiten mitten in die besonders herausfordernde Covid-Zeit.
Trotzdem sind wir planmässig am Werk. Probleme gab es nur vereinzelt, etwa bei der Integration älterer medizintechnischer Geräte, die wie sämtliche Geräte drahtlos mit dem Netzwerk verbunden werden.
Aber solches gehört zu einem normalen ICT-Projekt. Ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl, wenn ich abends schlafengehe.
Und die Pandemie haben wir in den Griff gekriegt. Sie hat sogar dafür gesorgt, dass wir schneller vorangekommen sind und damit denstark erhöhten Kommunikationsbedarf erfüllen konnten.»
Entscheidende Vorteile
Seit ein paar Monaten verfügt die SRO-Gruppe über ein hochmodernes Netzwerk, das mit einer starken Performance bezüglich aller vorgesehen Elemente glänzt.
«Es ist auch zukunftsfähig», ergänzt IT-Leiter Somaini, «wobei wir uns entschieden haben, diese Aufgabe mittels Managed ICT Services an die HINT AG auszulagern.
Ihre Fachleute befi nden sich täglich mit aktuellen Entwicklungen und Innovationen auf Tuchfühlung, was eine Partnerschaft nachhaltig gestaltet.
So können wir uns auf die zahlreichen Aufgaben im täglichen ICT-Betrieb konzentrieren und sind sicher, frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen, wenn weiterer Ausbau- oder Optimierungsbedarf entsteht.»
Die Frage nach den fünf wichtigsten Pluspunkten der aktuellen Lösung beantwortet Somaini wie folgt:
– Skalierbarkeit
– Ausfallsicherheit
– Security
– Geschwindigkeit
– Ausbaufähigkeit
«Unsere Mitarbeitenden haben den Nutzen rasch erkannt. Entsprechend gerne setzen sie die neuen Instrumente ein und freuen sich am massiv eingesparten administrativen Aufwand.
Ihr Fazit ist klar: Es ist toll, mehr Zeit für die Patienten zu haben.»
SRO konkret – Zahlen und Fakten
Die Spitalregion Oberaargau (SRO) besteht aus dem Akutspital in Langenthal den weiteren Aussenstandorten und der Pflegeinstitution dahlia oberaargau ag.
Die Zahlen für das Spital und seine drei ambulanten Standorte betrugen 2020:
– 9050 stationäre Patienten
– 72 000 ambulante Patienten (Akutversorgung)
– 5900 ambulante Patienten (Psychiatrie)
– 215 000 km Ambulanzen bei 6600 Einsätzen
– 1300 Mitarbeitende (auf rund 900 Vollzeitstellen)
– 165 Mio. Franken Umsatz
– 6 Operationssäle / 10 Intensivbetten
– Insgesamt 223 Betten
Die dahlia oberaargau ag, Tochtergesellschaft der SRO AG, stellt mit insgesamt 295 Betten einen sehr grossen Teil der Alters- und Pfl egebedarfs an 4 Standorten in der Region Oberaargau sicher:
– 295 Bettenplätze
– 102 000 Pfl egetage
– 95 % Auslastung
– 260 Vollzeitstellen
© Clinicum



Seit anderthalb Jahren hat uns die Corona-Krise fest im Griff, auch in unserer Region.
Aber nicht nur die Krise, auch die Massnahmen, die dagegen ergriffen werden und nicht
zuletzt die Situation in den Spitälern sorgt immer wieder für Aufsehen und heftige
Diskussionen. Andreas Kohli, Direktor Spital Region Oberaargau AG (SRO), erläutert im
Interview mit dem «Unter-Emmentaler» die Situation in seinem Unternehmen und sagt:
«Corona hat uns an Grenzen geführt, aber auch zusammengeschweisst.»
Walter Ryser im Gespräch mit Andreas Kohli, Direktor Spital Region Oberaargau (SRO)
Andreas Kohli, ich könnte mir vorstellen, dass Sie mittlerweile an einem Corona-Koller leiden und
langsam müde sind, über dieses Thema Auskunft zu geben?
Andreas Kohli: Ich sehe das vielmehr als Chance und Möglichkeit, unser Spital und seine Dienstleistungen
in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Corona gehört mittlerweile zu unserem Alltag,
die Pandemie ist einBestandteil unserer Arbeit. Deshalb beschäftigen wir uns täglich damit, genauso,
wie dies andere Leute in ihren Unternehmungen mit bestimmten, wiederkehrenden Themen auch tun.
Doch wir kommen nicht darum herum: Wie präsentiert sich die aktuelle Corona-Lage im Spital SRO in Langenthal?
Bis vor etwa drei Wochen verzeichneten wir steigende Fallzahlen, was auch auf unseren Spitalalltag
Auswirkungen hatte. In dieser Zeit hatten wir vier Corona-Patienten auf der Intensivstation,
die beatmet werden mussten. Insgesamt stehen uns fünf Beatmungsplätze und total
acht Intensivbetten zur Verfügung. Wie sie unschwer feststellen können, sind wir damit auf der Intensivstation
an den Anschlag gekommen. Auf der normalen Bettenstation verzeichneten wir weitere zwölf Corona-Patienten.
Mittlerweile hat sich die Situation etwas beruhigt, gibt es aktuell noch drei Corona-Patienten
auf der Intensivstation,die beatmet werden müssen und deren sechs Patienten auf der Bettenstation.
Hat diese Situation Auswirkungen auf den übrigen Spitalbetrieb?
Nein, bislang konnten wir den Betrieb aufrecht erhalten.
Wir mussten keine Operationen absagen oder an andere Spitäler übertragen. Etwa fünf Eingriffe mussten aber einige Tage hinausgeschoben werden.
Wie ist die Region Oberaargau bislang gesundheitlich durch die Corona-Krise gekommen?
In der ersten Phase hatten wir eine bizarre Situation, gab es doch Bereiche in unserem Betrieb,
die komplett stillstanden, während jener Teil des Spitals, der mit Corona beschäftigt war,
oftmals regelrecht überfordert war. Die Situation im Oberaargau war damals schwierig und hat uns hier im SRO sehr gefordert.
Die Belastung für die Mitarbeitenden war riesig und die Führungs-Crew war zusätzlich mit Aufgaben
konfrontiert, die nicht alltäglich sind, beispielsweise mit der Umsetzung der sehr strengen
Hygienemassnahmen für Patienten, Besuchende und Mitarbeitende oder der kurzfristige Aufbau
desScreenings und später des Impfzentrums. Zudem stellen wir heute fest, dass in der schlimmsten Phase
derPandemie etliche Leute dem Spital ferngeblieben sind und sich nicht behandeln liessen.
Das lässt sich anhand von Zahlen der Notfallstation ablesen. So sind vermutlich Herzinfarkte,
aber auch andere Leiden nicht oder zu spät behandelt worden.
Der Winter steht vor der Tür und damit droht sich die Corona-Krise erneut zu verschärfen. Wie wappnet
man sich beim SRO auf dieses Szenario?
Leider weiss niemand, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird. Wir pflegen deshalb einen engen
Kontakt mit den kantonalen Stellen und den Gesundheitsämtern, mit denen wöchentlich
Koordinationssitzungen stattfinden. Zudem finden bei uns intern tägliche Covid-Sitzungen statt.
Aufgrund dieser Sitzungen und Gespräche analysieren wir die Situation und richten unseren Betrieb bestmöglich
darauf aus, damit wir in der Lage sind, flexibel zu reagieren. In diesen Prozess müssen wir jeden einzelnen
Mitarbeitenden miteinbeziehen und anschauen, wie sich seine Lage präsentiert: Ist er noch einsatzfähig,
wie-steht es um seine mentale Belastung? Diese Situation ist sehr belastend für uns alle.
Welche Auswirkungen hatte Corona auf den Spitalalltag und die Angestellten?
Wir haben vor allem zwei Effekte gespürt: Einerseits wurde bei vielen Mitarbeitenden die Belastungsgrenze
erreicht, gleichzeitig hat die Krise die Leute aber auch zusammengeschweisst, es ist ein starkes
Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden. Ich staune immer wieder, mit welcher Motivation unsere
Mitarbeitenden in dieser schwierigen Situation bei der Arbeit sind und wie sie sich gegenseitig
unterstützen. Diese Solidarität und das übermässige Engagement kann man nicht genug hervorheben und
würdigen, es ist wirklich phänomenal.
Wie gingen und gehen die Verantwortlichen der SRO mit dieser Krise um, hat man im Umgang mit den
Mitarbeitenden den Führungsstil entsprechend angepasst oder neue Führungs-Instrumente installiert?
Natürlich mussten wir unseren Führungsstil anpassen. Vor allem bei der Kommunikation fand ein
rasanter Wandel statt. Diese ist im Eilzugstempo digitalisiert worden. Live-Streams, Videokonferenzen und
Chats bestimmen auch bei uns den Arbeitsalltag. Dazu kommt, dass nun seit fast zwei Jahren kaum noch
Personalfeste stattgefunden haben. Welchen Wert diese Anlässe haben, merkt man erst, wenn sie nicht
mehr durchgeführt werden, das darf man nicht unterschätzen. Denn dadurch gehen Nähe und
Verständnis verloren, zwischenmenschliche Faktoren, die digital nicht entstehen können. Deshalb legen wir momentan
besonderen Wert darauf, wie wir miteinander umgehen.
Hat Corona den Spitalalltag generell verändert?
Zweifellos, das kann man sagen. Gewisse Sachen, die sich mit Corona verändert haben, werden bleiben,
gerade im Bereich der Digitalisierung. Ich denke, dass wir in Zukunft für gewisse Veranstaltungen,
Workshops oder Schulungen nicht mehr immer nach Bern oder Zürich reisen werden. Mit Corona ist auch
die technische Entwicklung rascher vorangeschritten, was wir durchaus begrüssen.
Im Zusammenhang mit der Pandemie war und ist immer wieder vom Mangel an Pflegepersonal zu lesen.
Wie steht es diesbezüglich beim SRO?
Für die spezialisierte Pflege waren wir bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie unterdotiert.
Erstaunlicherweise ist es uns während der Pandemie gelungen, für die Intensivpflege neues Personal zu
rekrutieren. So gesehen sieht der Stellenplan bei uns nicht so düster aus, bleibt aber angespannt.
Worauf führen Sie denn diese überraschenden Zugänge zurück, hat Corona in der Bevölkerung zu einem
Helfer-Syndrom geführt?
Mit Corona hat dies nichts zu tun. Vielmehr spielen andere Faktoren eine entscheidende Rolle, das
Arbeitsumfeld, der Umgang miteinander im Spital, Verlässlichkeit seitens des Arbeitgebers, Arbeits- und
Rahmenbedingungen sowie die vorhandene In frastruktur.
Dafür war zu hören, dass diverse Fachärzte das SRO verlassen und zum Teil eigene Praxen eröffnet haben.
Was sind die Gründe für diese Abgänge?
Bei dieser Frage bewegen wir uns in einem heiklen Bereich. Ja, wir verzeichnen Abgänge, das kann ich
bestätigen. Sie betreffen zwei Fachbereiche, die Urologie sowie die Handchirurgie. Sehen Sie, auch in
einem Spital findet eine gewisse Fluktuation statt, wie in anderen Betrieben auch. Ein Spital bietet
Fachärzten oft auch eine ideale Plattform, um sich zu präsentieren, um dann später in die private Praxis zu gehen.
Dennoch, solche Abgänge sorgen für Aufsehen in der Öffentlichkeit und beflügeln Spekulationen.
Das verstehe ich durchaus, ist doch das Interesse der Öffentlichkeit an einem Spital deutlich grösser als an
anderen Unternehmungen, weshalb Wechsel in Kaderpositionen anders, stärker wahrgenommen und
diskutiert werden. Wir haben und leben eine klar definierte Fehler-Kultur. Wir sprechen Fehler an
und lernendaraus. Wie das geschieht ist auch eine Frage der persönlichen Haltung,
bei der gewisse Sachen aber nicht toleriert werden.
Bei gehäuften Abgängen in Grosskonzernen, Verwaltungen oder im Gesundheitswesen wird in der
Öffentlichkeit rasch spekuliert, dass diese auch im Zusammenhang mit einem entsprechenden
Betriebsklima stehen könnten. Wie steht es diesbezüglich beim SRO?
Wir sind uns des Stellenwertes unseres Betriebsklimas bewusst. Dieses muss funktionieren, sonst führt es
irgendwann zu einer Eskalation, weil im Spitalbetrieb die Drucksituationen oftmals sehr hoch sind.
Deshalb ist es wichtig, dass wir über ein gutes Betriebsklima verfügen, bei dem sich aber alle an gewisse
Spielregeln halten.
Wie wollen Sie die entstandenen Lücken innert nützlicher Frist schliessen?
Die Abgänge in der Urologie konnten bereits mit qualifizierten Leuten ersetzt werden. Im Bereich der
Handchirurgie wird uns dies ebenfalls gelingen.
Welche Auswirkungen auf den Spitalalltag haben diese Abgänge?
Die Abgänge sind zweifellos spürbar, aber nicht so, dass wir nun Patienten abweisen oder umplatzieren
müssten. Dieses Szenario versuchen wir zu vermeiden. Beide Bereiche sind übrigens sehr notfalllastig,
wenn sie als Spital also diese Bereiche nicht mehr anbieten können, müssen sie Patienten weiterreichen,
was nicht ideal ist. Doch so weit kommt es glücklicherweise nicht.
Was unternehmen Sie, damit gehäufte Abgänge innert kurzer Zeit in Zukunft nicht mehr vorkommen?
Gute Frage, das weiss ich nicht. Wir versuchen bei der Rekrutierung des Personals immer unser Bestes zu
geben, aber erst im Verlaufe der Zeit sieht man, ob es mit dem rekrutierten Personal auch funktioniert. Da
unterscheiden wir uns nicht von anderen Betrieben, die ebenfalls Abgänge im Kader zu verzeichnen haben
und diese nach bestem Wissen und Gewissen ersetzen.
Das SRO hat in den letzten Jahren enorm viel in den Ausbau der Infrastruktur und die medizinische
Versorgung investiert und ist dadurch eine hochmoderne Spital-Unternehmung geworden. Eigentlich
erstklassige Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb und eine Top-Adresse als Arbeitgeber.
Das ist zweifellos so, deshalb finden wir auch das entsprechende Personal, gerade auch in den zuvor
angesprochenen Spezialbereichen, weil wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, der über eine moderne
Infrastruktur verfügt. Wer heute im Gesundheitswesen einen Stellenwechsel in Betracht zieht, der überlegt
sich sehr gut, wohin er gehen möchte. Da muss so ziemlich alles stimmen und da spielt eine gute
Infrastruktur mit guten Arbeitsbedingungen eine entscheidende Rolle. Hier verfügen wir sicher über einige
Pluspunkte, die wir gegenüber den Stellensuchenden ins Feld führen können. Mit unserer früheren
Infrastruktur wäre dies nicht möglich und würde es uns deutlich schwerer fallen, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren.
Ein zentrales Thema ist aktuell auch die Impfbereitschaft der Bevölkerung, die äusserst kontrovers und
zunehmend gehässiger diskutiert wird. Welche Erfahrungen machen sie diesbezüglich im SRO?
Unsere Impfquote im Spital SRO ist ebenfalls zu tief und liegt ungefähr bei 70 Prozent. Damit ist unser
Spital bloss ein Abbild der gesamten Gesellschaft. Unser Wunschziel liegt bei einer Impfquote von 85
Prozent, was ich persönlich als sinnvoll erachte, wenn wir schnellstmöglich aus dieser Pandemie raus wollen.
Was unternehmen Sie, um die Impfquote im SRO zu erhöhen?
Wir geben laufend Empfehlungen ab und weisen unser Personal auf die Impfung, deren Schutz und
Vorteile hin. Aber letztendlich müssen auch bei uns die Leute selber entscheiden und ich stelle fest, dass
viele diesbezüglich eine klare Haltung haben und es schwer ist, jemanden vom Gegenteil zu überzeugen.
Dennoch möchte ich festhalten, dass sich unser gesamtes Personal bislang vorbildlich verhalten hat, was
die Hygiene- und Schutzmassnahmen betrifft. Diese sind bei uns rigoros eingehalten worden, was auch
zeigt, dass wir intern nur wenige Fälle zu verzeichnen hatten. Wir liefen nie Gefahr, gewisse Abteilungen
schliessen zu müssen, weil wir wegen Corona-Fällen zu wenig Personal gehabt hätten. Diesbezüglich
haben sich unsere Mitarbeitenden stets mit einer bewundernswerten Disziplin an die Vorgaben gehalten.
Wie erklären Sie sich als Spitaldirektor die erstaunlich tiefe Impfquote in der Schweiz – fehlt das Vertrauen
in unser Gesundheitssystem?
Das ist eben das Wesen des freiheitsliebenden Schweizers, mit seiner angeborenen Skepsis gegenüber der
Obrigkeit und der Ablehnung gegenüber Behörden und politischen Institutionen. Mit fehlendem Vertrauen
in das Gesundheitswesen hat das gar nichts zu tun, im Gegenteil, unser ganzes Gesundheitssystem
geniesst in unserem Land ein überaus hohes Ansehen und Vertrauen. Die Qualität unserer Gesundheits-
Dienstleistungen wird von den Leuten sehr hoch eingeschätzt, gilt zugleich aber auch als sehr teuer.
Wie lassen sich Leute aus ihrer Sicht von der Notwendigkeit einer Impfung zur Bekämpfung der Pandemie überzeugen?
Ich persönlich versuche niemanden umzustimmen, ich weiche solchen Diskussionen eher aus, weil ich der
Auffassung bin, dass die Meinungen in unserem Land gemacht sind. Deshalb verzichte ich diesbezüglich
auch auf irgendwelche missionarischen Aktivitäten.
Wie haben Sie persönlich die Corona-Krise bislang erlebt?
Ich habe die ganze Krise bislang gut überstanden, weil ich von meiner Arbeit her privilegiert bin. Unser
Betrieb war nie geschlossen, wie andere Unternehmungen. Ich durfte immer arbeiten. Dabei war
ich aber stets sehr vorsichtig unterwegs, auch im privaten Bereich, und ging kaum Risiken ein.
So bin ich auchgesundheitlich gut durch die Krise gekommen.
Was hat Sie in den letzten anderthalb Jahren am meisten gestört, was am meisten gefreut?
Was uns Spitälern zu schaffen macht, ist die Tarifstruktur, die dazu führt, dass wir vor allem im
ambulanten Bereich eine erhebliche Unterdeckung der Kosten haben. Die Herausforderung in diesem
Bereich ist riesig. Wir verfügen zwar über eine gute Eigenkapitaldecke, aber dennoch müssen in diesem
Bereich grundlegende Fragen geklärt werden. Gefreut habe ich mich in dieser Zeit über die Tatsache, dass
ich mit so vielen tollen Leuten zusammenarbeiten darf und eine sehr sinnhafte Tätigkeit ausüben kann, die
letztendlich sehr befriedigend ist.
Was tun Sie, um dem Corona-Hamsterrad einmal für einige Zeit zu entfliehen?
Meine sportlichen Aktivitäten wieder vermehrt pflegen und damit für einen guten Ausgleich zu meiner
Arbeit sorgen. Ich halte mich oft draussen auf – mache
© Unter Emmentaler
Kürzlich fand bei schönem Herbstwetter der 10. Jahresanlass der ambulanten Herzrehabilitation des Spitals Region Oberaargau (SRO) statt. 110 ehemalige Teilnehmende der Rehabilitation ergriffen die Gelegenheit und nahmen am Anlass teil, wie das SRO mitteilt. Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage seien die Teilnehmenden in drei Gruppen unterteilt worden. Die diesjährige Jahreswanderung habe die Teilnehmenden nach der Besammlung bei der Alten Mühle Langenthal die Langete entlanggeführt, heisst es weiter. Die ambulante kardiale Rehabilitation der SRO AG wurde im Herbst 2008 gegründet. Unter ärztlicher Leitung der Herzspezialisten Patrick Hilti, Michael Bergner, Fabian Zürcher, Stefan Bühler und Kai Schmidt sowie einem Team von Physiotherapeutinnen unter der Leitung von Susanne Sommerhalder und Ernährungsberatern des SRO konnten gemäss Mitteilung bisher über 900 Patienten von diesem Angebot in Wohnortnähe profitieren. Die ambulante Herzrehabilitation habe zum Ziel, nach einem Herzinfarkt oder einer Herzoperation die körperliche Leistungsfähigkeit wiederaufzubauen, das Vertrauen in den Körper zurückzugewinnen und Änderungsmöglichkeiten für einen langfristig gesunden Lebensstil aufzuzeigen.
© Berner Zeitung
Impfzentrum Langenthal - Ende August wird die Infrastruktur in der Alten Mühle geschlossen. Geimpft wird dann in der Spitalpraxis.
Der Kanton Bern hat beschlossen, seine Impfzentren per Ende August zu schliessen. Davon ist auch Langenthal betroffen. Ab September wird es dennoch möglich sein, in der Stadt eine Impfdosis zu erhalten.
Im zweiten Obergeschoss des Bettenhochhauses des Spitals Region Oberaargau (SRO) wird neu eine Spitalpraxis integriert, in der ausschliesslich Covid-19-Impfungen durchgeführt werden. Das Impfzentrum wird demnach nicht ersatzlos gestrichen, sondern in die Spitalpraxis übergeführt.
Täglich bis 300 Impfungen
Wie Alexander Imhof, Chefarzt Medizinische Klinik im SRO, auf Anfrage mitteilt, werden aktuell zwischen 100 und 300 Impfungen pro Tag durchgeführt. «Die Anzahl der Impfwilligen ist jedoch stark rückläufig, deshalb ist die Infrastruktur des Impfzentrums nicht mehr nötig», so Imhof. In der Spitalpraxis lasse sich die aktuelle und die zu erwartende Anzahl von Impfwilligen gut meistern.
Das Konzept sieht ab September eine Anzahl von täglich bis 300 Impfungen vor. Wie personalaufwendig die neue Spitalpraxis sein wird, kann Chefarzt Alexander Imhof noch nicht abschätzen: «Das hängt von der Anzahl der Impfungen und dem Covid-19-Screening ab.»
Zentrum Alte Mühle geht zu
Ersttermine im August können nicht mehr über das Impfzentrum Langenthal gebucht werden, sondern sind bereits in der Spitalpraxis aufgeschaltet. Damit ist der sogenannte Ort der Impfung im kantonalen Buchungsprogramm Vacme gemeint. Die Anmeldung geht immer noch über dieses Portal, nur muss der Termin bei der Spitalpraxis und nicht mehr beim Impfzentrum gebucht werden.
Die Impfungen werden noch bis zum 20. August im Impfzentrum in der Alten Mühle durchgeführt. Die folgenden Zweittermine werden nicht mehr am Mühleweg 23 stattfinden, sondern im Spital an der St. Urbanstrasse 67. Anmeldungen für die Covid-19-Impfungen in der Spitalpraxis können ab sofort direkt über Vacme getätigt werden. Gemäss SRO sind genügend Termine vorhanden
© Berner Zeitung
Bernhard Wetz tritt in den Ruhestand. Der Chirurg, der im Dorf eine eigene Praxis führt, hat die Schliessung des Buchser Akutspitals 1999 hautnah miterlebt.
Erst vor wenigen Stunden stand Bernhard Wetz noch im Operationssaal. Es sei die letzte Operation gewesen, die er selbst geleitet habe, sagt der Chirurg aus Herzogenbuchsee bei einem Gespräch vor dem Spital in Langenthal. Ende Monat geht der 67-Jährige in Pension. Bewusst habe er sich vor zwei Jahren entschlossen, noch über das Pensionsalter hinaus weiterzumachen und seinem Nachfolger so einen guten Übergang zu ermöglichen, sagt Wetz, der in Buchsi eine Praxis führt.
Sein Pensum hat der stellvertretende Chefarzt der Spital Region Oberaargau (SRO) in diesen zwei Jahren aber bereits heruntergeschraubt. «Ich hatte keinen Dienst mehr und habe nur noch operiert», sagt er. Zuvor war er zu 80 Prozent angestellt gewesen. Die anderen 20 Prozent entfielen auf seine chirurgische Praxis, die er nun schliesst.
Dass Bernhard Wetz voriges Jahr weniger zu tun hatte, hängt auch mit der Corona-Pandemie zusammen. Drei Monate hat er wegen dieser gar nicht mehr operieren können. Danach aber habe sich die Anzahl Operationen wieder normalisiert, erzählt er. «Auch wenn ich mir natürlich einen schöneren Abschluss vorstellen könnte», sagt Wetz. Aber vor zwei Jahren habe er noch nicht wissen können, was ihn erwartet.
11’000 Patientinnen und Patienten behandelt
Bevor Bernhard Wetz im Januar 2000 ins Spital nach Langenthal wechselte, war er im Bezirksspital Herzogenbuchsee tätig. Der Spezialarzt FMH für allgemeine Chirurgie hatte dort acht Jahre zuvor die Stelle des Chefarzts Chirurgie übernommen. Gleichzeitig eröffnete er eine selbstständige Praxis, die er zuerst im Spital, später dann an der Bitziusstrasse führte.
Der gebürtige Spiezer, der zuvor als Oberarzt im Tiefenauspital Bern und im Spital Interlaken gearbeitet hatte, kann sich noch gut an seine letzte Zeit in Herzogenbuchsee erinnern: «Wir hatten ein gutes Team zusammen und den Eindruck, dass wir auf dem aufsteigenden Ast sind.» Weshalb er denn vom damaligen Entscheid des Kantons, das Buchser Spital Ende 1999 zu schliessen, durchaus überrascht worden sei. Er erinnert sich daran, dass die Schliessung im Umfeld des Spitals mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen worden war.
«Ganz nüchtern betrachtet wussten wir, dass ein so kleines Akutspital keine Zukunft mehr hat.»
Auch wenn sich der Entscheid zuvor natürlich abgezeichnet habe, sagt Wetz. «Ganz nüchtern betrachtet wussten wir, dass ein so kleines Akutspital keine Zukunft mehr hat.» Er erinnert sich, dass es im Spital Herzogenbuchsee damals insgesamt 60 Betten gab. «Und das nächste Spital lag mit Langenthal sehr nahe.» Eben deshalb hätten er und seine Kolleginnen und Kollegen damals auch nicht gegen die Schliessung protestiert.
Vielmehr erkannten einige die Chance dahinter. Gemeinsam mit drei anderen Chefärzten wagte er den Sprung nach Langenthal. Was rückblickend betrachtet der richtige Entschluss gewesen sei, sagt Wetz. Habe ihm das SRO doch ermöglicht, sich fachlich weiterzuentwickeln. «Das Spital in Langenthal war besser ausgerüstet als jenes in Herzogenbuchsee», sagt er.
In seinen 29 Jahren in Herzogenbuchsee und Langenthal hat er über 11’000 Patientinnen und Patienten untersucht und behandelt. In der gleichen Zeit hat er bis zu 8000 Operationen durchgeführt. Der Buchser ist auf die bariatrische Chirurgie (Adipositas), also die Übergewichtschirurgie, spezialisiert.
Er brachte seinerzeit auch die sogenannte Schlüsselloch-Chirurgie neu als Routineverfahren in den Oberaargau. Bei dieser Operationsmethode wird mit kleinsten Schnitten gearbeitet, sodass die Verletzung der Haut möglichst gering ist. Später etablierte er am SRO federführend die laparoskopische Adipositas-Chirurgie.
«Es ist sehr schön geworden»
Das Geschehen rund um das ehemalige Spital in Herzogenbuchsee hat Bernhard Wetz in den vergangenen Jahren mitverfolgt. Es ist mittlerweile von der Dahlia Oberaargau zu einem Alters- und Pflegezentrum umgebaut worden. Zusammen mit dem Neubau stehen am Stelliweg 85 Zimmer zur Verfügung.
Der Panoramapark ist 2019 eröffnet worden und beherbergt nun unter anderem auch die Ambulante Psychiatrie und die Physiotherapie der SRO. Wetz hat die umgebauten Räumlichkeiten am Tag der offenen Tür besucht und freut sich über das Ergebnis: «Es ist sehr schön geworden.»
Er blickt zum Spital Langenthal hinauf. Wird er die Arbeit hier vermissen? «Langweilig wird es mir sicher nicht», sagt er und schmunzelt. Sobald es wieder möglich sei, wolle er auf Reisen gehen. «Das ist meine grosse Leidenschaft.»
© Berner Zeitung


Neues Angebot im Oberaargau - Die Psychiatrischen Dienste des Spitals Region Oberaargau betreuen Patientinnen und Patienten auch in ihrem gewohnten Umfeld –denn die vorhandenen Behandlungsplätze reichen nicht aus.
Die Corona-Krise stellt viele Menschen in psychischer Hinsicht auf eine harte Probe. Seit einem Jahr ist fast nichts mehr, wie es einmal war. Das kann belastend sein. Eine aktuelle Untersuchung aus den USA zeigt zum Beispiel, dass die Störung der körperlichen Aktivität während der Pandemie ein Hauptrisikofaktor für Depressionen ist.
Der Bedarf an psychologischer und psychiatrischer Betreuung steigt ohnehin schon seit einigen Jahren, wie das Spital Region Oberaargau (SRO) in einer Mitteilung schreibt. Es gab also bereits vor Corona eine negative Tendenz. SRO-Psychiaterin Farida Irani sieht den Grund unter anderem darin, dass viele Menschen im Alltag immer gestresster seien. Zudem sei die Hemmschwelle, Hilfe zu holen, gegenüber früher gesunken.
Nur für Erwachsene
Seit Februar leitet Irani ein noch fast unbekanntes Angebot der Psychiatrischen Dienste: die mobile Akutbehandlung. Sie richtet sich an Patientinnen und Patienten ab 18 Jahren, die sich in einer akuten psychischen Krise befinden und eine Behandlung zu Hause im gewohnten Umfeld einem stationären Aufenthalt vorziehen.
Die Psychiatrischen Dienste des SRO verfügen zurzeit zwar über 34 stationäre Plätze sowie zwei Tageskliniken mit 12 respektive 14 Behandlungsplätzen. Doch das reicht laut Irani nicht aus, um alle Patientinnen und Patienten der Region Oberaargau mit ihren etwa 80’000 Einwohnern zu betreuen.
Sie müssten immer wieder Personen an Kliniken ausserhalb der Region verweisen. «Wir wollen aber wenn möglich die Oberaargauerinnen und Oberaargauer in der Region versorgen können», sagt die leitende Ärztin der mobilen Akutpflege.
Nicht geeignet ist das Angebot für Menschen, bei denen eine Abhängigkeits- oder Demenzproblematik vorliegt, die andere gefährden oder ein nicht einschätzbares Suizidrisiko haben. Ob jemand zu Hause behandelt werden kann, müsse in jedem Fall einzeln entschieden werden. Sie führe mit dem Behandlungsteam immer ein Erstgespräch mit der Patientin oder dem Patienten durch. Sei eine Betreuung daheim nicht möglich, werden die Betroffenen laut Farida Irani weiterhin stationär behandelt.
Das Umfeld kennen lernen
«Durch die Behandlung zu Hause sehen die Ärzte und die Fachpersonen das direkte Umfeld des Patienten», erklärt die leitende Ärztin. «So können wir die Behandlung noch spezifischer auf die Betroffenen ausrichten als bei einem stationären Aufenthalt.» Bei einer Akutbehandlung daheim bestehe zudem kaum ein Risiko. «Wenn wir sehen, dass es nicht geht oder den Patienten nicht das bringt, was sie brauchen, können wir immer noch eine bessere Lösung suchen.»
Im erwähnten Erstgespräch versuchen die involvierten Fachleute der mobilen Akutpflege, das Problem zu erfassen. «Dann wird festgelegt, woran gearbeitet werden soll und was die Ziele sind. Schliesslich wird ein entsprechender Behandlungsplan mit den Patienten festgelegt», sagt Irani. Besonders wichtig sei auch das Mittragen dieser Behandlungsform seitens der Angehörigen. Diese würden durch die Betreuung entlastet und erhielten eine gewisse Sicherheit im Umgang mit den Patienten.
Der Kanton finanziert mit
Die Methode des «Home-Treatment», wie es in der Fachsprache heisst, wird seit einigen Jahren bereits in mehreren Regionen der Schweiz angewandt. Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern hat 2018 die Durchführung von Modellversuchen in drei Institutionen veranlasst. Eine davon sind die Psychiatrischen Dienste der SRO AG, wo es das Angebot seit einem Jahr gibt. Dadurch werden im Oberaargau 16 weitere Behandlungsplätze für psychisch akut erkrankte Menschen geschaffen.
Dieses Jahr wird das Angebot laut Irani noch vom Kanton mitfinanziert. Abgerechnet wird die Behandlung mittels Tarmed-Tarif über die Krankenkassen. Die leitende Ärztin ist überzeugt, dass dieses Modell günstiger ist als die stationäre Behandlung. Das Konzept sei auf etwa zwei Besuche pro Tag ausgelegt, wobei diese häufig durch die Pflegefachpersonen durchgeführt würden. Sicher einmal pro Woche finde zudem ein psychotherapeutischer Besuch statt.
Das Team der mobilen Akutpflege besteht neben der leitenden Ärztin Farida Irani aus acht Psychiatrie-Pflegefachpersonen, einer Psychologin, einer Assistenzärztin sowie einer Sozialarbeiterin. Sie alle wollen durch ihre Arbeit mit den Betroffenen in deren persönlichem Umfeld einen Beitrag in der Krisenbewältigung leisten.
© Berner Zeitung




Spende an Hilfsprojekt - Das Spital Region Oberaargau sendet 22 Paletten mit Ausrüstung an ein Hospital in Afrika. Kein leichtes Vorhaben.
Der gefüllte Container hatte es letztlich von Langenthal bis nach Eikwe geschafft. In der Kleinstadt im Westen Ghanas haben Angestellte des Hospitals St. Martin de Porres die Medizingeräte, verpackt auf 22 Paletten, in Empfang genommen. Das katholische Krankenhaus erhielt Monitore, Pumpen, Beatmungs geräte, Medikamentenwagen und Gebärbetten vom Spital Region Oberaargau (SRO) zugeschickt.
Die ausgemusterte medizinische Ausrüstung galt nach Schweizer Standards als nicht mehr modern. «Sie funktioniert aber noch einwandfrei», lässt sich Roger Giger, Ressortleiter Einkauf, Logistik und Medizintechnik der SRO AG, in einer Mitteilung zitieren. «Deshalb fing die Suche nach einer geeigneten Organisation an.» Dieses Unterfangen habe sich als nicht ganz einfach entpuppt.
Viele der angefragten Organisationen waren lediglich an einzelnen Geräten des SRO interessiert. Den Aufwand, die Ausrüstung zu sortieren, erachtete das Spital aber als zu gross - zudem wären so einige Medizingeräte übrig geblieben. Über persön liche Kontakte bei der Helios- Klinik im norddeutschen Cuxhaven stiess der stellvertretende SRO-Chefarzt Orthopädie, Jörg Ottensarendt, auf ein Hilfsprojekt in Ghana.
Das St. Martin de Porres Hospital betreut bis zu 200’000 Menschen und ist auf Ausrüstung sowie regelmässige Investitionen aus dem Ausland angewiesen. Der Betrieb des Krankenhauses werde bis auf eine deutsche Chirurgin mit einheimischen Kräften und staatlichen Mitteln gewährleistet, schreibt das SRO.
Alle einsatzfähigen Medizingeräte wurden darauf an einem Wochenende im Langenthaler Spital auf ihre Funktion hin überprüft, verpackt und mittels Lastwagen an die Nordseeküste spediert, wo der erste Schiffs container mit 22 Paletten be laden wurde. Nach Cuxhaven gelangten auch medizinische Güter aus anderen deutschen Kliniken. Weitere Container sollen folgen.
Die Überfahrt nach Ghana dauerte drei Wochen. Für den komplexen Wiederaufbau und die Inbetriebnahme der Geräte liess die Cuxhavener Radiologie-Praxis einen Röntgenassistenten für ein dreiwöchiges Praktikum einfliegen - bezahlt durch Spenden. Aufgrund der Dringlichkeit zur Stärkung des lokalen Gesundheitssystems erhielt dieser eines der wegen der Pandemie begrenzten Visa.
Die Monitore und Absaugpumpen aus Langenthal kamen dabei nach der Ankunft umgehend im neu eingerichteten Aufwachraum des Krankenhauses zum Einsatz.
© Berner Zeitung



Job im Spital Region Oberaargau - Die Deutsche Elaine Bentler arbeitete mal hier, mal dort. Über Umwege ist die Pflegerin in Langenthal gelandet und beruflich aufgestiegen.
Sie wollte wieder einmal in die Welt hinaus. Also bewarb sich Elaine Bentler eines Nachts bei verschiedenen Schweizer Kliniken. Denn im südlichen Nachbarland war sie beruflich noch nie. Seit die Dortmunderin vor zehn Jahren in Deutschland ihre Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin abgeschlossen hatte, war sie oft unterwegs: Erst arbeitete sie als Nanny in den USA, danach in Berlin auf einer Dialyseabteilung (künstliche Blutreinigung), ehe sie erneut loszog, um in der Türkei ehrenamtlich Patienten zu betreuen.
Später hielt es Elaine Bentler kurz wieder in Deutschland, bevor sie sich auf ein neuerliches Abenteuer in die Schweiz aufmachte. Hierhin, und darin sieht die heute 29-Jährige den grössten Vorteil, konnte sie mit ihrem Pferd auswandern. Anderthalb Jahre arbeitete sie zuerst im Kantonsspital Luzern, danach temporär bei Flex Medics in Aarau.
«In meinem Berufsfeld gibt es so viele Chancen und Möglichkeiten - man muss nur flexibel und offen sein», sagt Elaine Bentler. Das ist ihre Konstante: Sie möchte immer wieder über den eigenen Tellerrand hinausschauen können.
Selber an Covid-19 erkrankt
Die Pflegerin sitzt in einem kleinen Aufenthaltszimmer auf der Aufwachstation des Spitals Region Oberaargau (SRO). Hier gönnen sich die Angestellten während ihrer Schicht jeweils eine kurze Pause. Seit vergangenem April ist Elaine Bentler mittlerweile in Langenthal, bewarb sich über das Temporärbüro auf eine freie Stelle, um auf der damals neu geschaffenen Corona-Abteilung der SRO AG an Covid-19 erkrankte Personen zu betreuen.
Nur wenige Wochen vorher war sie selbst körperlich angeschlagen: Elaine Bentler erkrankte an ihrem früheren Arbeitsort am Virus. Sie litt an noch nie da gewesenen Gliederschmerzen und Atemnot, verlor Geruchs- und Geschmackssinn. Ihr Einsatz in Langenthal verzögerte sich. «Angst, künftig auf der Corona-Station zu arbeiten, hatte ich deswegen aber keine», sagt sie heute bestimmt.
Elaine Bentler erlebte im Spital Langenthal die erste Welle der Pandemie hautnah mit. Wie die Patienten über den Westeingang den Lift hoch in die umgenutzte Tagesklinik kamen. Wie der Zivildienst und viele Freiwillige im Einsatz standen. Und wie praktisch alle geplanten Operationen im Spital gestoppt wurden. Nicht nur für sie, sondern für das gesamte Team war die Pandemie Neuland. «Für mich war es sehr spannend, dabei zu sein.»
Beim SRO dabei ist Elaine Bentler auch heute noch. Ihre temporäre Anstellung verlängerte sie bis in den Herbst, im November wurde sie fest angestellt. In der Tagesklinik und Aufwachstation fehlten Stellenprozente, also entschied sie sich zu bleiben. Ihr gefalle die Grundstimmung im Haus, der Zusammenhalt im Team, wie sie sagt. «Ich war begeistert, wie umfangreich und herausfordernd das Fachgebiet ist.»
Auf ihrer Abteilung betreut Elaine Bentler seither Patientinnen und Patienten vor und nach der Operation. Die stationär behandelten Personen im Aufwachraum, die ambulant behandelten in der Tagesklinik. Die Deutsche schreitet vorbei an zugezogenen Vorhängen, dahinter abgeschirmt erholen sich Patienten von der überstandenen OP.
Die Tagesklinik ist an diesem Morgen etwa zur Hälfte belegt. Im Aufwachraum dagegen herrscht Stille, die Patienten kommen erst am späteren Morgen hierher. Es sind Sportferien, doch auch wegen der anhaltenden Pandemie ist die Anzahl der Operationen im letzten halben Jahr wieder etwas zurückgegangen.
Elaine Bentler hat derweil eine weitere Stufe auf ihrer Karriereleiter erklommen: Seit Jahresbeginn ist sie stellvertretende Bereichsleiterin der Tagesklinik und des Aufwachraums im Spital Region Oberaargau. Sie übernimmt jetzt auch administrative Aufgaben, kontrolliert etwa die Dienstpläne.
Weiterziehen ist für sie, die im aargauischen Lenzburg lebt, zurzeit kein Thema. Sie möchte nun längerfristig im Spital Region Oberaargau bleiben. Elaine Bentler ist sesshaft geworden. Vorerst zumindest.
© Berner Zeitung

SRO-Bettenhochhaus ist renoviert - Provisorium des Spitals Langenthal wird demontiert.
Momentan ist ein grosser Kran der Firma Zaugg aus Rohrbach auf dem Gelände des Spitals Region Oberaargau (SRO) in Langenthal zu sehen: Mit seiner Hilfe wird der Bettenpavillon, der während der Renovierungs- und Umbauarbeiten des Bettenhochhauses als Ausweichstation diente, komplett rückgebaut.
Schicht für Schicht schweben die Wände und Decken an den starken Seilen des über 200 Tonnen schweren Krans über das Spitalareal. Das provisorische Gebäude mit den 11 Patientenzimmern, 22 Betten und der ganzen Infrastruktur diente der SRO fünf Jahre lang als Ausweich station.
Bald wieder Rasen und Blumen
Zuerst wurde Anfang 2016 das Haus Süd (Frauenklinik, Onkologie und Intensivstation) umgebaut, ab 2018 folgte die umfassende Renovation des Bettenhochhauses. An der Stelle des Pavillons, zwischen der stationären Psychiatrie und dem Ärztehaus 1, werden danach wieder Rasen und Blumen das Areal zieren.
Nach einer über zweijährigen Bauzeit (von Mai 2018 bis November 2020) ist das Bettenhochhaus fertig, wie die SRO AG in einer Mitteilung schreibt. «Die Infrastruktur konnte modernisiert und so die Betriebsabläufe optimiert werden.» Nun erfreue sich das Spital an den schönen Einer- und Zweierzimmern und an der Urologiepraxis im neunten Obergeschoss - und vor allem daran, den Patientinnen und Patienten den Aufenthalt angenehm und zeitgemäss zu gestalten.
© Berner Zeitung

